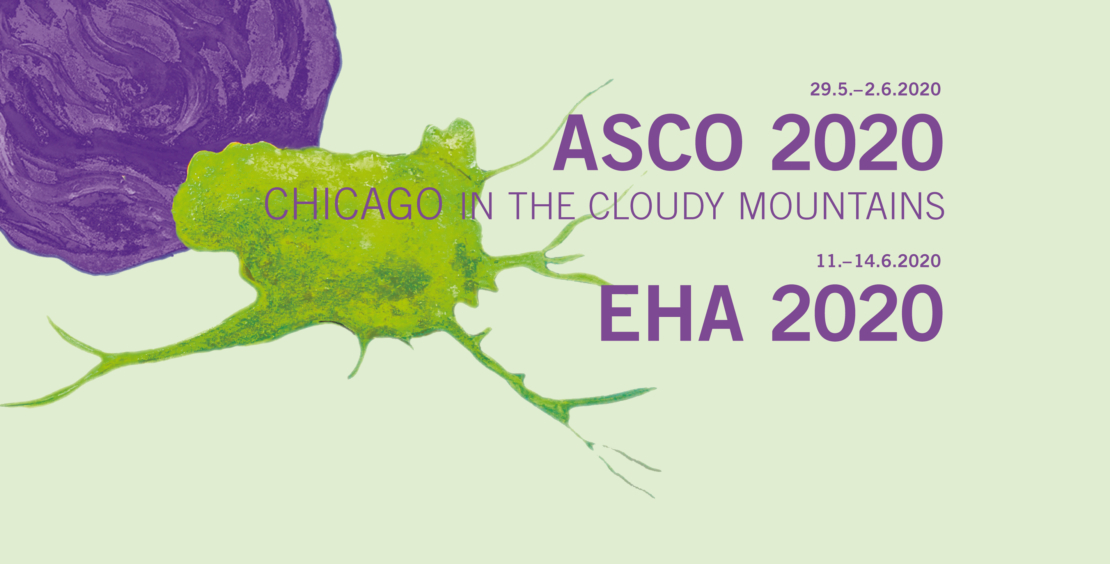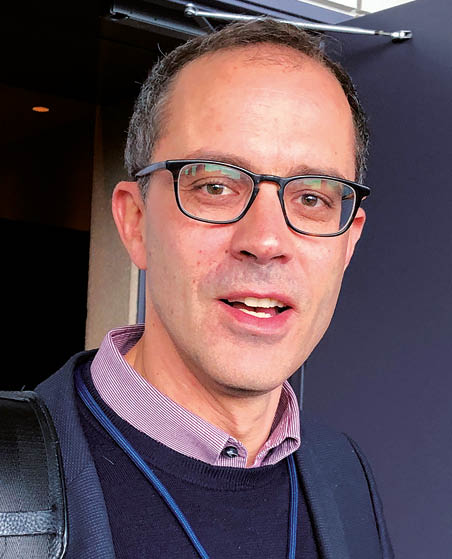- Experteninterviews ASCO 2020
Im Gespräch mit PD Dr. med. Richard Cathomas, Chur
Welches waren für Sie die Highlights am diesjährigen ASCO?
Im Bereich der urogenitalen Tumore wurden erneut sehr viele interessante und relevante Daten präsentiert. Der Fokus lag dieses Jahr auf dem metastasierten Urothelkarzinom (mUC), wobei erstmals eine signifikante und klinisch relevante Verlängerung des Gesamtüberlebens in der Erstlinientherapie erzielt werden konnte. Die Studie Javelin 100 wurde von Tom Powles an der Plenary session vorgestellt (LBA1). Dabei wurden Patienten mit mUC, die nach 4-6 Zyklen einer Platin-haltigen Erstlinienchemotherapie eine Stabilisierung erreicht hatten (CR, PR oder SD), randomisiert in eine Therapie mit dem PD-L1 Antikörper Avelumab oder best supportive care. Mittels Erhaltungstherapie mit Avelumab konnte eine Verlängerung des Gesamtüberlebens um 7.1 Monate erzielt werden (21.4 vs 14.3 Monate, HR 0.69, p= <0.001). Am ESMO 2020 werden weitere Resultate dieser Studie erwartet, aber man darf schon jetzt sagen, dass die Erhaltungstherapie mit Avelumab wohl ein neuer Therapiestandard nach erfolgter platinhaltiger Erstlinienchemotherapie darstellen wird.
Welche Resultate/Erkenntnisse haben Sie überrascht? Positiv oder negativ?
Im Bereich des Prostatakarzinoms wurde die erste randomisierte Studie mit dem Radioliganden Lutetium-PSMA (Lu-PSMA; der Beta-Strahler Lutetium ist dabei an einen PSMA Antikörper gebunden) präsentiert (abs 5500). Es handelt sich um eine randomisierte Phase 2 Studie mit 200 Patienten wobei Lu-PSMA gegen Cabazitaxel in der Drittlinientherapie verglichen wurde. Der primäre Endpunkt eines verbesserten PSA Ansprechens wurde erreicht, jedoch stehen die Ergebnisse der klinisch relevanten Endpunkte wie PFS und OS noch aus. Die PSMA-gerichtete Therapie (mittels Radioligandentherapie oder mit anderen Methoden) ist sicher sehr zukunftsträchtig und wird in den kommenden Jahren weiter intensiv erforscht werden.
Ein negatives Resulat lieferte die Phase 3 Studie mit adjuvanter Immuntherapie mit Atezolizumab nach radikaler Zystektomie bei Patienten mit muskelinvasivem Blasenkarzinom: die Studie IMvigor 010 (abs 5000) zeigte keinen Vorteil des krankheitsfreien Überlebens (DFS) durch Therapie mit Atezolizumab während eines Jahres im Vergleich mit Placebo (HR 0.89, p=0.2446). Es werden im gleichen Setting und mit praktisch gleichem Design noch die Resultate von 2 weiteren Studien mit Checkpoint Inhibitoren erwartet (Pembrolizumab, Nivolumab), vorerst jedoch ist von einer adjuvanten Immuntherapie für Patienten nach radikaler Zystektomie sicher abzusehen.
Welche Erkenntnisse haben für Ihre tägliche Praxis die grösste Bedeutung?
Am ASCO 2020 wurden wiederum Biomarker-Analysen von verschiedenen grossen Phase 3 Studien sowohl beim Nierenzellkkarzinom wie auch beim Blasenkarzinom gezeigt. Noch finden diese Resultate keinen Eingang in die reguläre tägliche Arbeit, die vielen kleinen Fortschritte sind jedoch interessant und werden wahrscheinlich bald zu einer verbesserten individualisierten Therapie führen. Es wird auch bei den urogentialen Tumoren zunehmend kleine spezfische Patientenpopulationen mit besonders gutem Benefit von ausgewählten Therapien geben und es wird wichtig sein, diese Erkenntnisse anzuwenden sobald sie validiert sind.
In welchen Bereichen sehen Sie noch grösseren Forschungsbedarf?
Wie schon angetönt ist das «one size fits all» Prinzip, das weiterhin in den meisten randomisierten Studien angewandt wird, bald obsolet. Leider führt dieser Ansatz zudem auch zu negativen Resultaten mit Therapiekombinationen von denen ausgewählte Subgruppen allenfalls profitieren könnten. Es muss daher darum gehen, den individualisierten Ansatz auch in randomisierten Studien vertieft zu prüfen, dies gilt für alle urogenitale Tumore.
Haben Sie noch einen anderen bemerkenswerten Punkt aus Ihrer persönlichen Sicht?
Die ausschliesslich virtuelle Durchführung des Meetings hat durch das Wegfallen der Reise einen grossen Zeitgewinn gebracht und ist natürlich auch klimapolitisch zu begrüssen. Die Sessions konnten dank der guten Umsetzung durch ASCO problemlos verfolgt werden. Zudem wurden die Resultate der Studien auf verschiedenen Kanälen rasch und intensiv gestreut. Der Informationsfluss war somit sehr gut. Deutlich zu kurz gekommen ist jedoch eine kritische Auseinandersetzung mit den neuen Daten durch den fehlenden persönlichen Austausch mit nationalen und internationalen Kollegen. Dies ist meines Erachtens ein grosser Nachteil des virtuellen Meetings und müsste in Zukunft mit verbesserten interaktiven Foren angegangen werden.
Wie beurteilen Sie die virtuelle Form der Berichterstattung – Zukunft?
Während mehreren Tagen herrschte fast eine virtuelle Überflutung mit sehr vielen verschiedenen Angeboten online und per email. In Zukunft ist meines Erachtens eine Kanalisierung wünschenswert mit Fokus auf die Qualität sowohl der Auswahl als insbesondere auch der Interpretation der Studien. Eine derartige Aufarbeitung bedingt jedoch Zeitaufwand auf allen Seiten und ist in schnelllebigen Zeiten nicht immer einfach – jedoch zwingend notwendig.
Eleonore E. Droux
Im Gespräch mit Prof. Dr. med. Christoph Renner, Zürich
Welches waren für Sie die Highlights am diesjährigen ASCO?
Sicherlich die weiteren Entwicklungen auf dem Gebiet der Immuntherapie aber auch zielgerichteten Therapie und ich möchte 3 Studien hervorheben:
a) Neuer Standard auf dem Gebiet der Immuntherapie ist der Einsatz des PD-L1-Antikörpers Avelumab bei Patienten mit fortgeschrittenem Blasenkarzinom nach Chemotherapie, da die Erhaltungstherapie das mediane Gesamtüberleben um median 7 Monate gegenüber Best Supportive Care verlängert.
b) Ein weiterer Immuntherapiestandard wird der Einsatz von Pembrolizumab bei Patienten mit sog. MSI-H metastasiertem Kolorektalkarzinom in der Erstlinientherapie sein. Die Zwischenanalyse der KEYNOTE-177-Studie zeigte für Pembrolizumab ein medianes PFS von 16,5 Monaten gegenüber 8,2 Monaten mit Chemotherapie (P = 0,0002).
c) Patienten mit nicht-kleinzelligem, EGFR mutiertem Lungenkrebs im Stadium IB-IIIA (NSCLC) profitieren von einer adjuvanten Behandlung mit Osimertinib und weisen eine signifikante Verlängerung des krankheitsfreien Überlebens (DFS) auf (ADAURA-Studie).
Welche Resultate/Erkenntnisse haben Sie überrascht? Positiv oder negativ?
Wie bereits ausgeführt: Toll zu sehen, dass die Immuntherapie und «targeted therapies» klassische Behandlungen ergänzen bzw. sogar ersetzen kann. Etwas enttäuschend war die Datenlage zu Phase III Studien auf dem Gebiet der Hämatologie. So zeigte z.B. die mit Spannung erwartete ENDURANCE Studie keinen Vorteil für Carfilzomib im Vergleich zu Bortezomib in Kombination mit Revlimid + Dexamethason in der Erstlinientherapie von Myelompatienten.
Welche Erkenntnisse haben für Ihre tägliche Arbeit die grösste Bedeutung?
Auf dem Gebiet der Hämato-Onkologie werden leider diesmal keine «practice-changing» Studien präsentiert.
In welchen Bereichen sehen Sie noch grösseren Forschungsbedarf?
Weiterhin gezielt individuell Tumorzellen selektiv zu zerstören bzw. das Immunsystem so zu aktivieren, dass es die Krankheit kontrollieren kann. Bei vielen Erkrankungen kann die bisherige Immuntherapie jedoch nur bei einem kleinen Patientenanteil eine Krankheitskontrolle erzielen und daher besteht noch grosser Verbesserungsbedarf. Für zielgerichtete Therapien ist die weitere Entschlüsselung der molekularen intrazellulären Prozesse und ihre Fehlstellung im Rahmen der Krebsentstehung von entscheidender Bedeutung.
Haben Sie noch einen anderen bemerkenswerten Punkt aus Ihrer persönlichen Sicht?
Nein
Wie beurteilen Sie die virtuelle Form der Berichterstattung – Zukunft?
Mit gemischten Gefühlen. Das Wegfallen der Anreise als auch der Zeitumstellung und die hohe Flexibilität, Beiträge dann anzuschauen, wenn man persönlich Zeit hat, war eine neue Erfahrung und zeigte, dass man wirklich nicht mehr vor Ort sein muss. Damit war es für einen als Teilnehmer entspannter und für die Umwelt sicherlich verträglicher. Es fehlte jedoch die intensive Diskussion und der mögliche fachliche Austausch mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort.
Eleonore E. Droux
Im Gespräch mit Prof. Dr. med. Roger von Moos, Chur
Welches waren für Sie die Highlights am diesjährigen ASCO?
Das erste Mal in der Geschichte des ASCO Kongresses fand dieser virtuell statt. Ich war überrascht, wie das Programm Komitee es geschafft hat diesen Kongress in der kurzen Zeit auf virtuell umzustellen. Mit Stolz erfüllt es mich auch zu sehen, wie das Programm Komitee von ASCO in the Cloudy Mountains es schaffte das vor Ort Programm das normalerweise in Flüeliranft stattfindet auf ein virtuelles interaktives Programm mit Sendezentrale am SAKK Koordinationszentrum in Bern umzustellen. Es zeigt, dass die Onkologie Welt rasch auf veränderte Bedingungen reagieren kann und dass die Weiterbildung so in hoher Qualität gewährleistet ist.
Welche Resultate haben Sie überrascht? Positiv oder negativ?
Im Bereich der Behandlung des Melanoms wurden verschiedene Studien vorgestellt, welche mit reduzierten Dosen Ipililumab arbeiten in Kombination mit voller PD1 Dosierung. Zuerst war da die PRADO Studie (10002) welche Patienten mit Stadium IIIb/c neoadjuvant behandelt hat. Dabei erreichten 61% eine CR oder near CR. Diesen Patienten wurde dann eine primäre Lymphadenektomie erspart, was sich auch in der Lebensqualität auszeichnete. Mit dieser relativ kleinen Studie konnte gezeigt werden, dass ein solches Vorgehen möglich ist und die Wirksamkeit hoch ist. Natürlich ist das noch nicht für die klinische Routine zu empfehlen, aber die Forschung sollte unbedingt weiter in diese Richtung gehen.
Olson et al (10004) stellten eine Studie mit Ipililumab low dose (1mg/kg) in Kombination mit Pembrolizumab (200mg flat rate dose) nach vorgängiger First line Therapie mit einem PD1 AK vor. Dabei konnte eine erstaunliche Response Rate von 27% erreicht werden, was deutlich besser ist als bei früheren Studien mit Ipililumab full dose alleine. Auch positiv zu erwähnen ist die deutlich geringere Toxizität.
Welche Erkenntnisse haben für Ihre tägliche Arbeit die grösste Bedeutung?
Bei zwei grossen Studien (EORTC 1325-MG/Keynote 054) (10000) und der COMBI-AD Studie (10001) wurden Langzeitergebnisse bei adjuvanter Behandlung von Melanomen präsentiert. Dabei konnte gezeigt werden, dass Pembrolizumab gegenüber Placebo das Relapse Free Survival auch nach 3 Jahren als auch die kummulative Inzidenz von Fernmetastasen klinisch sinnvoll verbessern kann. Gleiches kann auch für Patienten mit BRAF mutiertem Melanom und Therapie mit Dabrafenib und Trametinib postuliert werden. Hier zeigt sich auch nach 5 Jahren ein deutlich verbessertes Metastasen freies Ueberleben für Patienten mit Therapie gegenüber Placebo. Im Gegensatz zu den Immuntherapien ist es hier so, dass die Nebenwirkungen nach Ende der Therapie vollständig regredient sind.
Wir haben somit Gewissheit, dass adjuvante Therapien beim Melanom einen Langzeiteffekt haben und allen Patienten in diesen Tumorstadien angeboten werden sollten.
In welchen Bereichen sehen Sie noch grösseren Forschungsbedarf?
Beim metastasierten Melanom ist nach wie vor unklar, wer von Anfang an eine intensive Kombinationstherapie braucht und davon profitiert und wer nicht. Somit können wir nach wie vor keine Patientengruppe identifizieren bei denen der approach «start low go slow» genügend wäre.
Auch bezüglich Dosierung von Ipililumab in Kombination mit einem Checkpoint Inhibitor herrscht nach wie vor Unklarheit. Des weiteren ist auch die Therapie Länge mit einem PD1 AK bei Patienten mit CR unklar.
Patienten mit LDH über der Norm haben darüber hinaus trotz intensiver Kombinationsbehandlungen nach wie vor sehr schlechte Karten. In diesem Bereich sind weitere Studien notwendig, die SAKK hat dies erkannt und wird hier in den nächsten Monaten aktiv werden.
Haben Sie noch einen anderen bemerkenswerten Punkt aus Ihrer persönlichen Sicht?
Nein
Wie beurteilen Sie die virtuelle Form der Berichterstattung – Zukunft?
Rein virtuelle Kongresse sind wie Fussballspiele ohne Zuschauer. Es fehlt das entscheidende Etwas. Allem voran der kritische Austausch mit den Kollegen vor Ort, das Zusammensitzen und Austauschen von Ideen für neue Studien, die internationale Vernetzung und letztlich auch Hintergrundinformationen zu den Studienresulaten die in einer 7-15 minütigen Präsentation schlicht keinen Platz finden. Ich denke man sollte in Zunkunft das Beste aus den zwei Welten vereinen und zu Hybridformen übergehen, um beim Beispiel Fussball zu bleiben. Zuschauer im Stadium mit Liveübertragung in Pubs (Chicago in the mountains) und der Möglichkeit die Präsentationen auch zu Hause allein geniessen zu können.
Eleonore E. Droux