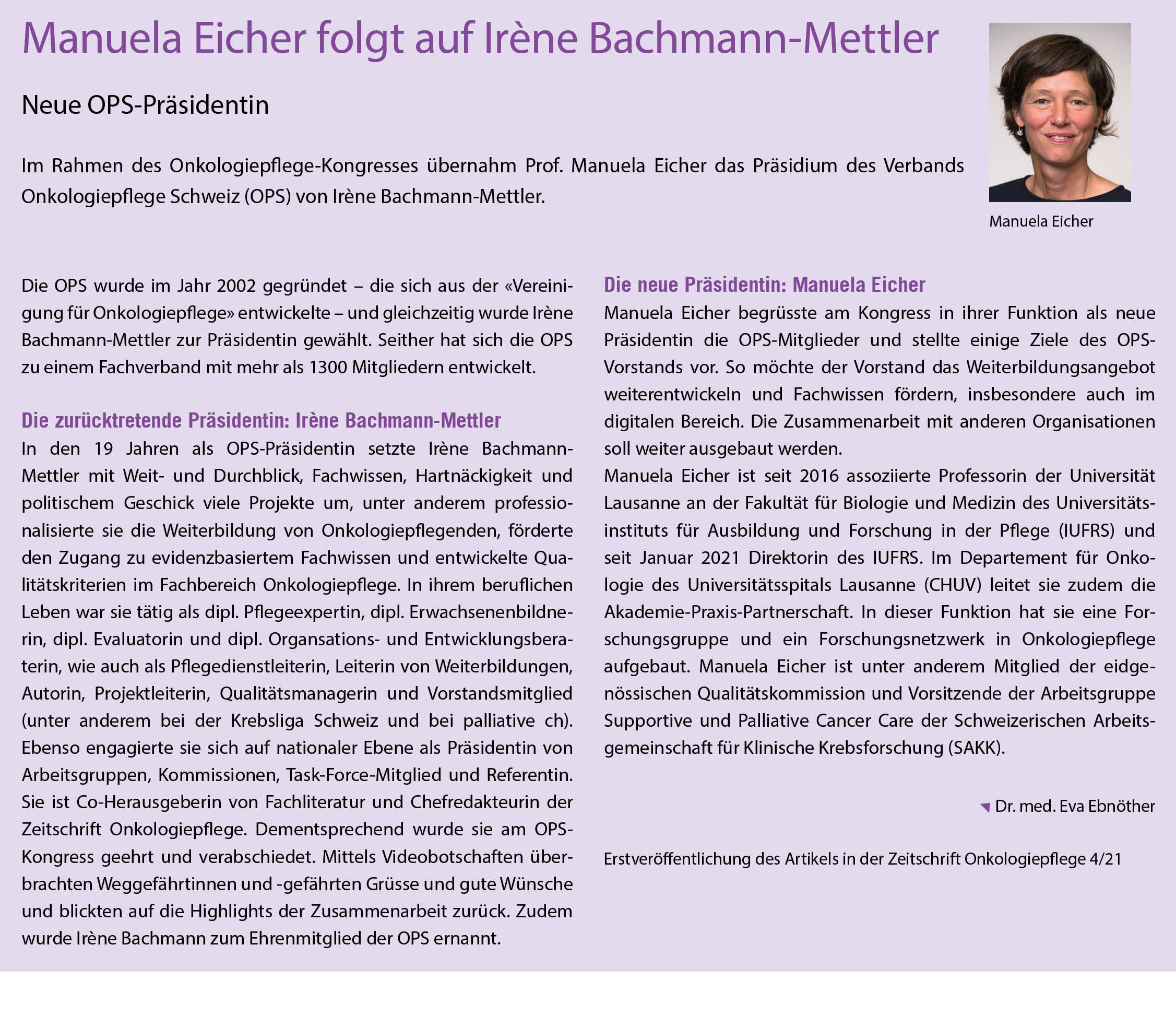- «Das Netzwerken lag mir sehr am Herzen»
Irène Bachmann-Mettler hat die Geschicke der OPS während 19 Jahren als Präsidentin geleitet. Im September ist sie zurückgetreten und hat den Führungsstab an Manuela Eicher übergeben. Im Interview blickt Irène Bachmann zurück auf ihre persönlichen OPS-Highlights und verrät, was sie in Zukunft machen möchte.

Irène, wieso wurdest du vor über 45 Jahren Pflegefachfrau – damals noch Krankenschwester?
Diesen Berufswunsch hatte ich schon während der Sekundarschule – warum, weiss ich eigentlich nicht. Vielleicht lag es an den «Susanne Barden»-Romanen, die ich damals verschlang. Darin wurde der Lebensweg einer Krankenschwester geschildert, und diese Welt des Spitals beeindruckte mich sehr. Ich wollte nie etwas anderes werden.
Warum hast du dich in Onkologiepflege spezialisiert?
Nach der Ausbildung hatte ich eine Stelle in St. Gallen, und die Oberschwester schickte mich auf die Onkologie. Ich war sofort fasziniert von dem Fach. Man war sehr nahe bei den Patienten und den Angehörigen, hoffte und bangte mit ihnen, und begleitete die Menschen über eine lange Zeit, von der Diagnose und oft bis zum Tod. Es war eine ganzheitliche Pflege, und ich war davon ganz erfüllt. Wir hatten auf der Station ein tolles Team und ich konnte bald als Stationsleiterin die Hämatologie übernehmen. Das war anfangs der 80er-Jahre. Man führte die ersten aplasierenden Chemotherapien durch und pflegte die Patienten in Isolationszelten. Weil das Spital Jules Bordet in Brüssel eine anerkannte Station dafür hatte, ging ich für ein paar Wochen nach Belgien, um diese spezielle Pflege zu lernen. Zurück in St. Gallen richteten wir Pflegenden und das Ärzteteam selbst die ersten Isolationszelte ein.
Gab es etwas, das dir damals an deiner Arbeit besonders gefiel?
Die Pflege von Patientinnen und Patienten mit Leukämien wuchs mir ans Herz. Das waren junge Menschen, und sehr viele starben. Wir versuchten oft zu organisieren, dass die Betroffenen zum Sterben heimgehen konnten. Es gab noch keine spezialisierte Spitex, also gingen wir Pflegenden vom Spital aus zu den Patienten nach Hause und machten bereits damals Palliative Care. Als Pflegende in der Onkologie waren wir Pionierinnen und konnten neues Wissen, das wir uns auch auf internationalen Kongressen aneigneten, mit grossem Enthusiasmus umsetzen. Die Forschung brachte immer wieder neue Erkenntnisse, auch in der Supportivtherapie, und wir konnten die Pflege weiterentwicklen.
Wie hast du diese rasante Veränderung der Onkologie wahrgenommen?
Besonders sind mir die Patienten mit Hodenkrebs in Erinnerung geblieben. Das waren junge, gesunde Männer, die operiert wurden, danach eine sehr belastende Chemotherapie erhielten und trotzdem oft starben. Dann wurde Cisplatin neu als Chemotherapeutikum eingesetzt – und viele dieser Männer konnten geheilt werden. Dasselbe sahen wir auch bei Menschen mit Leukämien oder Hodgkin-Lymphom: Viele dieser Patientinnen und Patienten kamen nach intensiven Therapien jahrelang auf die Onkologie für Kontrollen, wo auch wir Pflegende sie immer wieder sahen. Oder wir konnten sie in einer palliativen Situation gut unterstützen und begleiten. Das hat uns motiviert und gestärkt!
Was war schwierig?
Anfangs waren die schweren Symptome der Krankheiten und die unerwünschten Nebenwirkungen der Therapien sehr belastend. Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen belasteten die Betroffenen und die Pflegenden. Eine gewisse Ohnmacht war spürbar, denn es gab kaum gute Konzepte zu deren Behandlung.
Wurde dir die Arbeit mit schwer kranken und sterbenden Menschen nie zu viel?
Ich konnte damit gut umgehen. Es gab zwar viele traurige Erlebnisse, aber ich habe damit nie gehadert. Wenn ich nach Hause ging, konnte ich abschalten. Mein Mann und ich hatten ein reiches soziales und kulturelles Leben, wir gingen in Konzerte, ins Theater, wandern oder wir trafen Freunde – das war wichtig. Oft gingen wir nach einem anstrengenden Tag ins Restaurant essen und erzählten uns, was wir erlebt hatten. Das entlastete mich. Mein Mann hat mich immer unterstützt – er hatte nie ein Problem damit, wenn ich zu spät kam oder er warten musste. Als ich auf der Leukämie-Abteilung arbeitete und ein Patient eine halbe Stunde vor Arbeitsschluss Fieber bekam, dann blieb ich. Mein Mann wartete manchmal stundenlang im Auto auf mich, bis ich fertig war und wir essen gehen konnten. Das habe ich sehr geschätzt. Und ich arbeitete in tollen Teams, in denen wir uns gegenseitig unterstützten. Ein paar von uns treffen sich noch heute einmal pro Jahr.
Die Onkologiepflege Schweiz gibt es seit knapp 20 Jahren. Wie hat sie sich entwickelt?
Ab 1979 trafen sich interessierte Pflegende der ersten onkologischen Abteilungen der Schweiz. Bei diesen Treffen war ich bereits dabei. 1987 gründeten wir die Schweizerische Interessengruppe für Onkologiepflege und 1998 die Vereinigung für Onkologiepflege. Daraus entstand 2002 die Onkologiepflege Schweiz. Also bereits ab den 80er Jahren versammelten sich immer mehr Pflegende aus Spitälern der ganzen Schweiz zum fachlichen Austausch, insbesondere bezüglich Symptomkontrolle und psychischen Belastungen. Wir organisierten Kongresse und arbeiteten beispielsweise mit der Schweizerischen Arbeitsgruppe für Klinische Krebsforschung (SAKK) und der European Oncology Nursing Society (EONS) zusammen. Mir war immer wichtig, dass ich mich weiterbilden konnte – und meine Kolleginnen und ich wollten, dass auch andere Pflegende sich Wissen aneignen und ihre Erfahrungen austauschen konnten. Es bildeten sich auch regionale Gruppen und wir boten bald auch Weiterbildungen an und verfassten Leitlinien und Konzepte für das Symptommanagement oder zur Sicherheit im Umgang mit Zytostatika.
Welches sind deine persönlichen Highlights aus dieser Zeit?
Da gibt es viele. Ausserhalb der OPS war es sehr bedeutend, als in den frühen 80er Jahren die ersten Weiterbildungslehrgänge angeboten wurden und diese dann auch anerkannt wurden. Dies hat die Onkologiepflege in der Schweiz gefördert und gestärkt. Auch die Kongresse und die regionalen Tagungen waren Highlights, weil man nebst dem neuem Wissen und Erfahrungsaustausch Gleichgesinnte treffen konnte und sich eine «Community» bildete. Wir waren damals schon gute Netzwerkerinnen und das lag mir sehr am Herzen. Dieses Gefühl, dass man nicht allein ist und andere dieselben – guten und schlechten – Erfahrungen machen, hat mich immer gestärkt. Ich vertrat die Onkologiepflege in anderen Gremien, zum Beispiel bei der Krebsliga Schweiz, bei Oncosuisse oder palliative ch oder bei der Entwicklung der Kommunikationskurse der Krebsliga Schweiz. Diese Vorstands- und Entwicklungsarbeit machte ich sehr gern.
Wie war die Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten?
Die Zusammenarbeit mit Onkologinnen und Onkologen erlebte ich sehr gut – es war klar, dass es ohne einander nicht geht und die gegenseitige Akzeptanz war selbstverständlich. Mein persönlicher Eindruck ist aber, dass die Zusammenarbeit in der Pionierphase der Onkologie kollegialer und partnerschaftlicher war als heute. Das Hierarchiedenken hat in den letzten Jahren in den Spitälern eher zugenommen. Vielleicht liegt das daran, dass sich manche Ärztinnen und Ärzte abgrenzen wollen, um so den besonderen Status aufrechtzuerhalten. In Gremien mit Ärztinnen und Ärzten musste ich mich oft für das spezifische Wissen und die Aufgaben der Pflegenden engagieren, zum Beispiel wenn Gelder verteilt oder Projekte finanziert wurden.
Hast du ein Beispiel?
In den letzten Jahren haben wir Qualitätskriterien für Onkologiepflegende definiert. Dazu gehören auch 20 Stunden Weiterbildung pro Jahr. Aus meiner Sicht ist diese Anzahl Stunden notwendig, damit die Pflegenden auf qualitativ hohem Niveau arbeiten können, denn die Onkologie ist ja ein Fach, dass sich sehr rasch verändert. Von vielen Spitälern und onkologischen Praxen erhielten wir positive Rückmeldungen, jedoch auch sehr kritische, dass 20 Stunden Weiterbildung pro Jahr für Pflegende viel zu viel seien. So etwas ärgert mich, denn da fehlt die Wertschätzung für das Fachwissen und die Aufgaben der Onkologiepflegenden. Diese Gespräche brauchen Geduld. Nach 45 Jahren Engagement ist mir diese teilweise abhanden gekommen. Doch ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam auf einem guten Weg sind.
Gibt es Erlebnisse, die dich besonders geprägt haben?
Ich möchte zwei erwähnen. Als erstes die Arbeit in der Palliative Care. In den 90er Jahren machte ich eine Ausbildung als Erwachsenenbildnerin. Als Diplomarbeit konzipierte ich eine interdisziplinäre Weiterbildung in Palliative Care, die damals noch mehrheitlich auf Menschen mit einer Krebserkrankung ausgerichtet war. Mit diesem Konzept ging ich zur Krebsliga Schweiz, die diesen Weiterbildungslehrgang dann während zehn Jahren finanzierte. Wir haben rund 200 Personen ausgebildet. Viele von ihnen sind noch heute als Expertinnen und Führungspersonen tätig. Im interdisziplinären Leitungsteam und unter den Teilnehmenden hatten wir einen intensiven Austausch, der mich menschlich und fachlich stark prägte. Die Auseinandersetzung mit Leben und Tod war enorm bereichernd, wie auch die Gespräche mit und die Begleitung von kranken Menschen und deren Familien in der Praxis. Das zweite ist die Forschung. Ich war immer fasziniert von der Suche nach neuen und besseren Behandlungs- und Pflegeansätzen und davon, wie sich diese Entwicklungen direkt auf die Lebensverlängerung und -qualität der betroffenen Menschen und die Medizin und Pflege auswirken.
Was hast du als OPS-Präsidentin am liebsten gemacht?
Ich führte gerne Projekte durch, die einen praktischen Nutzen haben. Zum Beispiel das Erstellen von evidenzbasierten Leitlinien und Konzepten für die Praxis – das fand ich sehr wert- und sinnvoll. Aber auch die Entwicklung der Verbandsstrukturen und der Angebote oder das Vernetzen von Fachpersonen schätzte ich.
Gab es auch Dinge, die dich gestört haben?
Ich bin eher ungeduldig und hätte im Rahmen der OPS gern noch mehr Projekte verwirklicht. Dafür hatten wir aber manchmal schlicht zu wenig Expertinnen. Wenn man 100% arbeitet und eventuell noch eine Familie hat, ist der Aufwand hoch, daneben noch für die OPS tätig zu sein. Manche meiner Kolleginnen absolvierten auch ein Studium und hatten deswegen kaum noch Zeit für die OPS. Ich war in dieser Hinsicht privilegiert: Meine Arbeitgeber, das Kantonsspital St. Gallen und das Universitätsspital Zürich, stellten mir pro Jahr zehn Tage für die Verbandsarbeit zur Verfügung – das war eine grosse Entlastung. Auch deshalb konnte ich neben dem Präsidium verschiedene Weiterbildungen absolvieren.
Als du jünger warst, war es unüblich, dass man als verheiratete Frau Karriere machte. Hast du deswegen Anfeindungen erlebt?
Nein. In meinem Beruf waren wir nur Frauen, und das Verständnis füreinander war gross. Ich selbst war von meinem Beruf so erfüllt und auch von der Möglichkeit, hinauszugehen und mit anderen zusammenzuarbeiten, dass ich mir nicht vorstellen konnte, Hausfrau und Mutter zu sein. Mein Mann und ich schätzten unsere Freiheit und die vielfältigen Tätigkeiten sehr.
Nun bist du pensioniert und als OPS-Präsidentin zurückgetreten. Hast du Pläne für die Zukunft?
Ich habe den richtigen Zeitpunkt gewählt, um aufzuhören. Ich konnte mich schrittweise aus dem Berufsleben verabschieden. Die OPS-Zeitschrift werde ich vorläufig weiter als Redaktorin begleiten, und das auch sehr gern – so bleibe ich in Kontakt mit dem Fachwissen und meinen Weggefährtinnen.
Momentan spiele ich viel Golf, das ist meine grosse Passion. Ich gehe gerne wandern und nehme mir Zeit für mich persönlich und für das, was in den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen ist. Zum Beispiel spontan mit meinem Mann ein paar Tage nach Mailand fahren um Kunstausstellungen zu besuchen und die Italianità zu erleben oder mein Zuhause geniessen. Oder einfach, wenn ich Lust habe, zwei Stunden in den Wald gehen oder ins Yoga. Das ist meine grosse Freiheit. In den nächsten Jahren möchte ich kein Amt und keine freiwilligen Tätigkeiten übernehmen – nur kein Aktivismus. Wahrscheinlich werde ich Vorlesungen besuchen – ich interessiere mich unter anderem für Kunstgeschichte, Philosophie und griechische Mythologie – und als Steinbildnerin im Maggiatal schnuppern. Oder auch einfach einmal ohne Zeitdruck ein Buch lesen, eine Aussicht geniessen und Sein.
Zum Abschluss: Was stand für dich im Mittelpunkt deiner Tätigkeiten?
Die Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen. Es ist sehr wichtig, die Pflegenden zu stärken und weiterzubilden. Immer mit dem Ziel, die Pflege der Patientinnen und Patienten – und somit hoffentlich ihre Lebensqualität – zu verbessern. Das war für mich sinnstiftend, bereichend und machte mir Freude.
Dr. med. Eva Ebnöther
Erstveröffentlichung des Artikels in der Zeitschrift Onkologiepflege 4/21