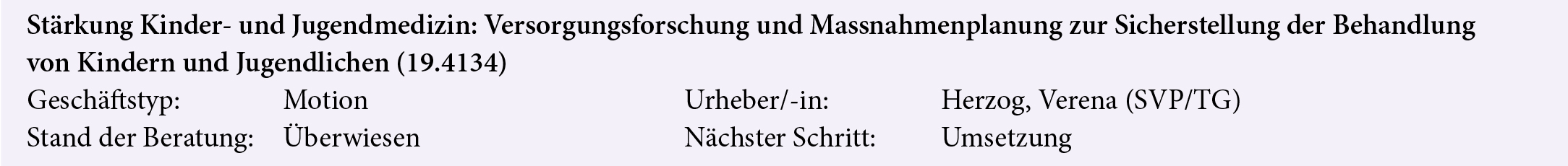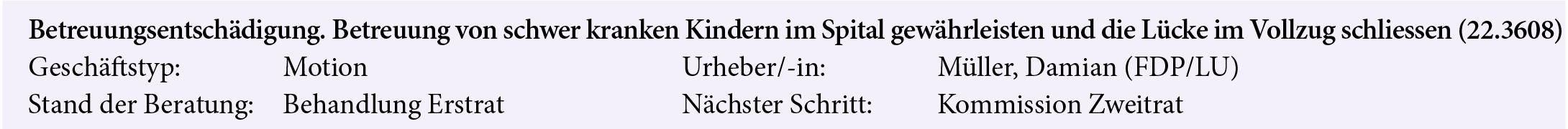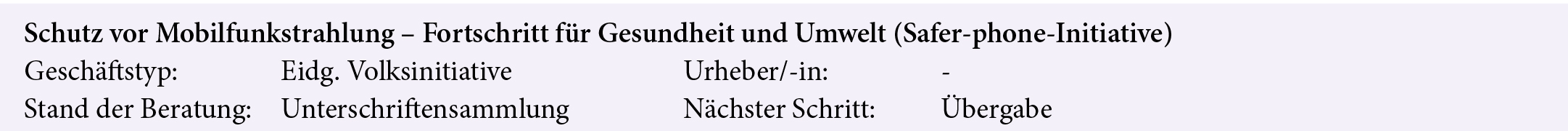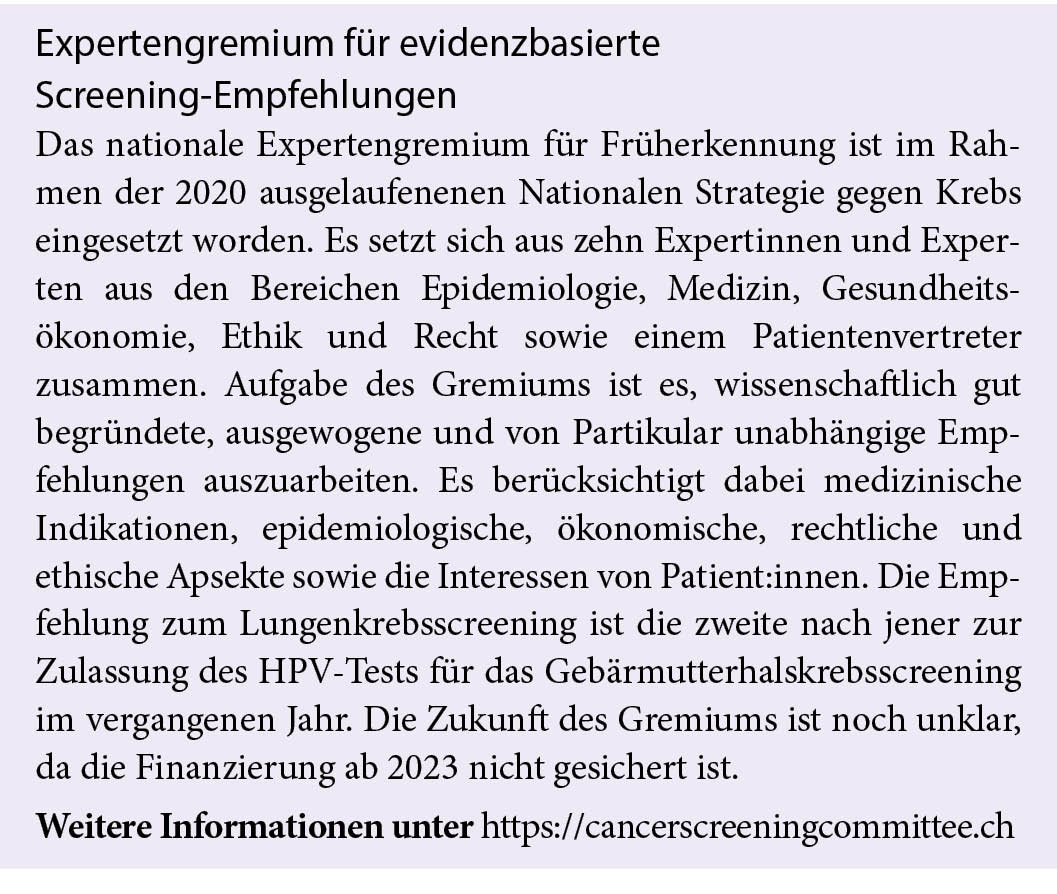- Aktuelle Krebspolitik
Im Folgenden werden krebspolitisch relevante Entscheide aus der Herbstsession 2022 vorgestellt.
Der Bund soll periodisch eine spezifische Versorgungsforschung im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin in Auftrag geben, wobei der volkswirtschaftliche Nutzen der Kinder- und Jugendmedizin zu evaluieren sei. Nach dem Nationalrat in der Herbstsession 2021 nahm nun auch der Ständerat die Motion an. Der Bundesrat ist beauftragt, das Anliegen umzusetzen.
Die Oncosuisse begrüsst die Förderung der Versorgungsforschung, auch im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin. Diese liefert die Grundlagen, damit Bund und Kantone im Rahmen ihrer Kompetenzen geeignete Massnahmen zur Vermeidung einer allfälligen medizinische Unterversorgung ergreifen können.
Der Bundesrat soll beauftragt werden, eine Botschaft zur Änderung des EOG bezüglich der Betreuungsentschädigung für erwerbstätige Eltern von Kindern mit schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu unterbreiten. Entgegen dem Antrag des Bundesrates hiess der Ständerat die Motion mit 31 zu 9 Stimmen bei 1 Enthaltung gut.
Die Motion kommt in die zuständige Kommission des Ständerates. Ein Termin ist noch nicht bekannt.
Seit dem 1. Juli 2021 können erwerbstätige Eltern von Kindern mit schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen einen Betreuungsurlaub beziehen. Seither zeigt sich, dass das Gesetz die vorgesehene Entlastung von Eltern und Arbeitgebern vielfach nicht gewährleistet und die Bestimmung ihr ursprüngliches Ziel damit nur zu einem kleinen Teil erreicht. Viele Familien fallen durch die Maschen des Gesetzes. Die derzeit gültigen Kriterien für einen Betreuungsurlaub sind realitätsfern, da schwer kranke Kinder mit guter Prognose (etwa nach schweren Operationen) oder mit vorgeburtlichen Erkrankungen sie kaum erfüllen können. Doch auch diese Kinder brauchen ihre Eltern im Spital.
Die Oncosuisse begrüsst deshalb, dass durch das Festlegen der Anzahl Spitaltage ein objektivierbares Kriterium geschaffen wird, mit welchem die heutige Ungleichbehandlung zwischen unterschiedlichen Ausgleichskassen beendet werden kann.
Mit der Volksinitiative soll die Bundesverfassung dahingehend angepasst werden, dass der Bund Vorschriften über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung erlässt. In diesem Zusammenhang ist im Parlament noch die Motion 20.3237 (Mobilfunknetz – Rahmenbedingungen für einen raschen Aufbau jetzt schaffen) hängig. Die KVF-S hat bei der Verwaltung Abklärung verlangt zu den Messverfahren bezüglich Immissionsgrenzwerte. Ausserdem hat sie die Verwaltung beauftragt, den Bericht zum Monitoring der nichtionisierenden Strahlung vom Juni 2022 in Bezug auf Orte, an denen sich regelmässig besonders schutzbedürftige Personen aufhalten, zu ergänzen.
Die Unterschriftensammlung läuft bis zum 13.März 2024. Die Motion will die KVF-S im Frühling wieder behandeln.
Grundsätzlich ist ein umfassender Strahlenschutz aus Sicht der Krebsprävention wichtig. Für hochfrequente elektromagnetische Strahlung konnte bisher wissenschaftlich jedoch weder eine klare gesundheitliche Gefährdung noch eine klare gesundheitliche Unbedenklichkeit nachgewiesen werden. Dies widerspiegelt sich beispielsweise auch in der Einstufung dieser Strahlung als «möglicherweise krebserregend» durch die Internationalen Krebsforschungsagentur (IARC).
Es empfiehlt sich deshalb, die individuelle Strahlenbelastung durch entsprechende nieder- und hochfrequente Felder im Sinne der Vorsorge niedrig zu halten. Da durchschnittlich über 90% der individuellen Strahlenbelastung durch das eigene Handy verursacht werden, ist ein gutes Netz mit entsprechend hochwertiger Verbindungsqualität und Optimierung auf möglichst tiefe Strahlung zentral.
Entsprechend lehnt Oncosuisse die Forderung der Volksinitiative aufgrund der fehlenden Evidenz und der realitätsfernen Umsetzung ab.
Für weitere Informationen: info@oncosuisse.ch
Screening von Risikopersonen soll Zahl der Todesfälle durch Lungenkrebs reduzieren
Risikopersonen sollen sich in der Schweiz auch ohne Symptome auf Lungenkrebs untersuchen lassen können. Das nationale Expertengremium Früherkennung schlägt vor, ein Lungenkrebs-Screening mittels niedrigdosierter Computertomographie anzubieten. Es kam nach detaillierter Evaluation der klinischen Evidenz, der Wirtschaftlichkeit und der ethischen Argumente zum Schluss, dass die Vorteile überwiegen. Das Gremium verzichtete aber darauf, eine genaue Zielgruppe zu definieren.
Rund 4’700 Menschen erkranken in der Schweiz jährlich an Lungenkrebs, rund 3’300 sterben daran. Damit ist Lungenkrebs in der Schweiz wie auch weltweit die häufigste krebsbedingte Todesursache. Rauchen ist mit Abstand grösste Risikofaktor für Lungenkrebs: über 80% der Diagnosen sind darauf zurückzuführen.
Da Lungenkrebs im Frühstadium oftmals keine oder sehr unspezifische Symptome verursacht, wird er häufig erst in weit fortgeschrittenem Stadium diagnostiziert. Eine Heilung ist dann meistens nicht mehr möglich. Dies legt die Idee nahe, gefährdete Personen gezielt auf Lungenkrebs zu untersuchen und so Tumorerkrankungen früher zu erkennen und die Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Frühere Versuche eines Screenings mittels konventionellem Thoraxröntgen erwiesen sich jedoch als nicht zielführend.
Screening mit niedrigdosierter Computertomographie
Neuere Studien, die das Lungenkrebs-Screening mittels niedrigdosierter Computertomographie untersuchten, weisen jetzt bessere Resultate auf. International sind deshalb bereits verschiedene entsprechende Studien und Pilotprojekte angelaufen. So bietet Manchester seit 2019 in einem mobilen Bus auf Supermarktparkplätzen den 55- bis 74-Jährigen aktuellen und ehemaligen Raucher:innen einen Lungen-Check und ein Lungenkrebsscreening an. Die ersten Erfahrungen damit waren so positiv, dass das Projekt jetzt in England ausgeweitet werden soll.
Das unabhängige Expertengremium Früherkennung hat sich der Frage angenommen, ob auch in der Schweiz ein Lungenkrebsscreening eingeführt werden soll. Zehn unabhängige Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen haben die ethischen Fragen des Lungenkrebsscreenings, dessen klinische Wirksamkeit sowie Kosteneffektivität und Budget Impact beurteilt und im vergangenen November eine evidenzbasierte Empfehlung für die Schweiz abgegeben. Sie schlagen vor, für Risikogruppen ein Screening mittels niedrigdosierter Computertomographie anzubieten.
Anzahl Todesfälle durch Lungenkrebs kann verringert werden
Marcel Zwahlen, der Präsident des Gremiums, stellte die Empfehlung an einer Oncosuisse-Session am Swiss Oncology and Hematology Congress (SOHC) am 18. November in Basel vor. «Über einen Zeitraum von 10 Jahren kann ein Lungenkrebsscreening wahrscheinlich 43 Lungenkrebs-Todesfälle pro 10’000 Personen verhindern», sagte er. Die Evidenz weise zudem darauf hin, dass mit einem Screening mehr Lungenkrebs in einem früheren Stadium diagnostiziert würden. Dies würde wiederum die Behandlungschancen erhöhen.
Das Expertengremium geht davon aus, dass eine Mehrheit von informierten Personen mit erhöhtem Lungenkrebsrisiko ein Screening zumindest in Betracht ziehen würde. Die Risikopersonen sollten Zugang zum Lungenkrebsscreening haben, sagte Zwahlen.
Keine detaillierte Empfehlung zur Zielgruppe
Allerdings verzichtete das Expertengremium auf eine detaillierte Definition der Zielgruppe. Dies etwa im Gegensatz zur EU-Gesundheitskommission, die das Screening für Personen im Alter von 50 bis 75 Jahren empfiehlt, die mindestens 30-Pack-Jahre geraucht haben (entspricht zum Beispiel 30 Jahre lang mindestens ein Pack Zigarette pro Tag). Im Gremium wurden verschiedene Szenarien angeschaut und ihre Kostenfolgen modelliert, sagte Zwahlen. Dabei hätten sich bezüglich Kosteneffizienz keine grossen Unterschiede gezeigt. Praktisch alle Szenarien seien kosteneffizient. Entsprechend habe sich im Gremium nicht ein einziges Szenario als Favorit durchgesetzt. Vielmehr sei die Empfehlung, dass die Zielgruppe so gewählt werde, dass die Implementierung eines Screenings praktikabel und möglichst gerecht sei.
Das Expertengremium schlägt jedoch vor, das Alter für ein Screening eher tief anzusetzen, die Untersuchung bereits moderaten Raucher:innen anzubieten und auch Personen einzuschliessen, die mit dem Rauchen aufgehört haben.
Informierte Entscheidung und organisierte Programme
Wichtig ist für das Expertengremium, dass bei der Implementierung die Zugangsgerechtigkeit einen hohen Stellenwert hat. Rauchen und Lungenkrebs seien in Bevölkerungsgruppen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status häufiger anzutreffen. Ein Screening-Angebot mache nur Sinn, wenn diese Bevölkerungsgruppen erreicht werden könnten. Bei der Entscheidung für oder gegen die Teilnahme an einem Screening soll entsprechend geschultes Gesundheitspersonal die Risikopersonen unterstützen. Weiter soll Risikopersonen unabhängig davon, ob sie eine Früherkennungsuntersuchung machen, Unterstützung beim Rauchstopp angeboten werden.
Das Expertengremium empfiehlt ausdrücklich, die Früherkennung im Rahmen organisierter Programme anzubieten. Nur solche können die Qualität und Reproduzierbarkeit der nach einem auffälligen Befund angezeigten Folgeuntersuchungen, eine strukturierte und zielgruppenorientierte Einladung der Risikopopulation sowie eine effiziente Überwachung und Evaluierung des Screenings gewährleisten. Ein Programm würde auch die Befreiung von der Franchise nach den üblichen Regeln der gesetzlichen Krankenversicherung ermöglichen, was eine weitere wichtige Voraussetzung für Zugangsgerechtigkeit sei.