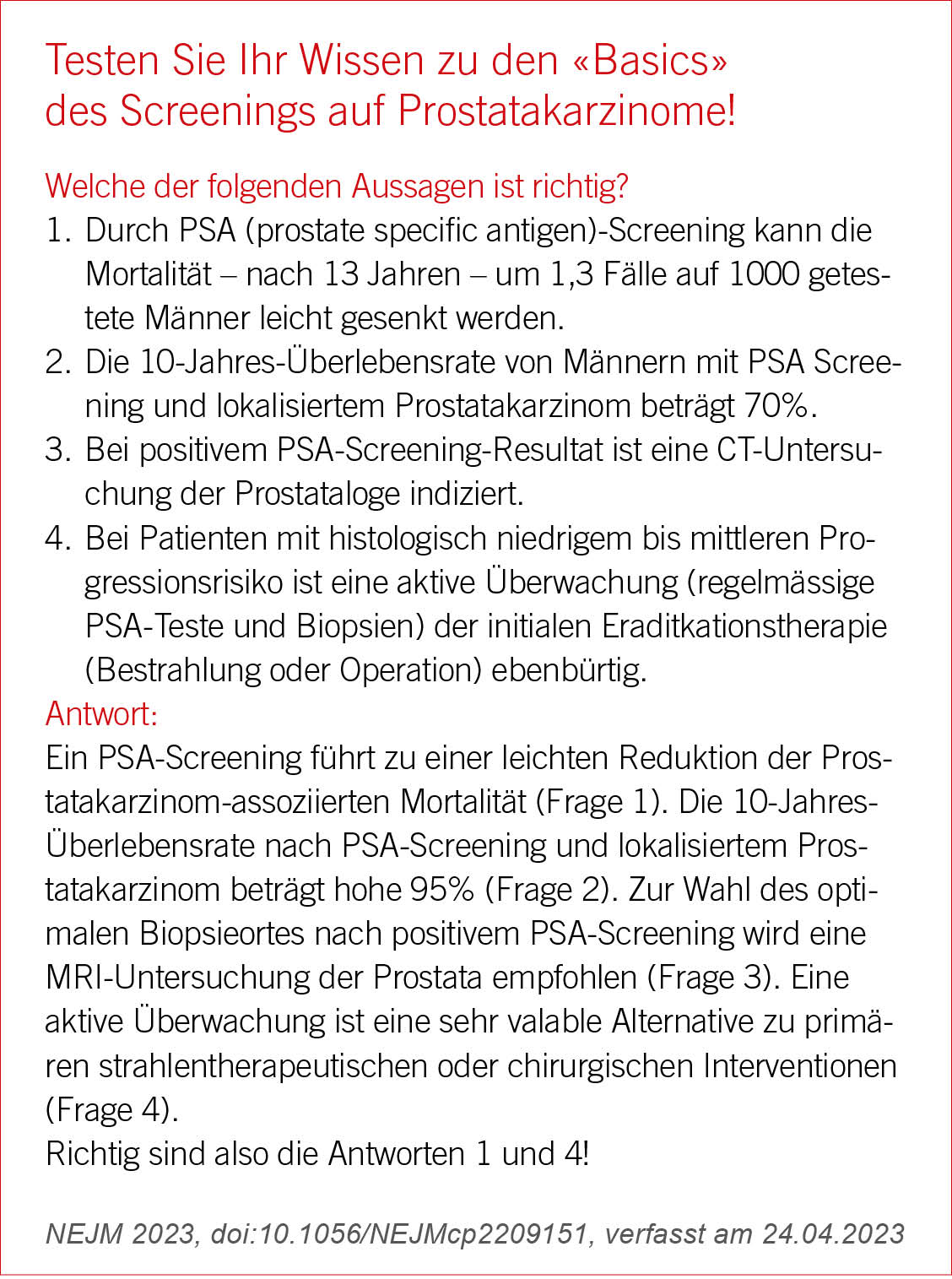- RETO KRAPFs Medical Voice
Frisch ab Presse:
Winterschlaf der Bären ohne die menschlichen Immobilisationsfolgen
Bären machen einen langen Winterschlaf, in dem sie nahezu ganz immobilisiert sind. Trotzdem entwickeln sie im Gegensatz zum Menschen keine Osteoporose, keinen Muskelschwund und nur selten Thromboembolien. Interessant ist auch, dass die glomeruläre Filtrationsrate auf praktisch 0 ml/min sinkt und Bären im Winter eine Anurie aufweisen. Gleichwohl entwickeln sie keine Urämie. Dies obwohl die Stickstoffproduktion bei Verwendung der Sommerreserven anhält. Bären verhindern eine Urämie durch die alternative Sekretion von Harnstoff und Ammoniak ins Darmlumen (1). Bären, wenn im Winterschlaf gestört, bewahren sich auch zumindest einen Teil ihrer kardiovaskulären Fitness und können – im Gegensatz zum Menschen nach längerer Immobilisation – erstaunlich behende aus ihrer Höhle (ihrem Bett) galoppieren!

Also könnten wir von Bären für die Prävention und Behandlung z.B. über die oben geschilderten Immobilisations-bedingten Nebenwirkungen wohl viel lernen! Einer skandinavischen Studie entnehmen wir, dass Thromboembolien bei Bären nicht unbekannt sind, sie also als Vergleichsspezies durchaus qualifizieren. Aber, im Winterschlaf können die Bären die Aktivierung der Blutplättchen durch Suppression verschiedener, Plättchen-aktivierender Plasmaproteine hemmen, am ausgeprägtesten ist die Suppression des sog «heat shock protein 47, HSP47» (2). Dieses Protein wird auch bei immobilisierten Menschen supprimiert und könnte also ein, wenn auch beim Menschen nicht 100% wirksamer Schutzmechanismus sein. Vielleicht wäre ein HSP47 Antagonist, zusätzlich zu oder gar als Ersatz (?) der heute gebräuchlichen präventiven Antikoagulation, ein lohnendes Interventionsziel.
1. Kidney International 2012, doi.org/10.1038/ki.2012.396, 2. Science 2023, DOI: 10.1126/science.abo5044, verfasst am 21.04.2023
Endovaskuläre Thrombektomie bis zu 24 Stunden und auch bei grossen ischämischen Hirninfarkten
Die intravaskuläre (durch Aspiration und/oder Stents) Thrombektomie durchgeführt in der Regel innerhalb von 6h nach Auftreten der ersten Symptome und kleineren bis mittelgrossen Infarkten führt bei einer Rekanalisationsrate von etwa 75% zu einer signifikant höheren funktionellen Unabhängigkeit nach 90 Tagen (mit einer eindrücklichen «number needed to treat» von lediglich 2,3!).
Allerdings wird die Gesamtmortalität nicht vermindert. Es gibt nun drei unabhängige Studien (zusammen etwa 1000 Patienntinnen und Patienten aus japanischen, chinesischen und US-amerikanischen Populationen), die einen vergleichbaren Nutzen auch bei grossen Hirninfarkten (ischämisches Hirnvolumen >50 ml) zeigen (1,2,3). Grosse Hirninfarkte waren von den früheren Studien ausgeschlossen worden, wegen der als zu gross eingeschätzten Gefahr eines Reperfusionsschadens und von Einblutungen ins nekrotische Hirngewebe. Bezüglich des Zeitpunktes oder des «windows of opportunity» zeigt eine holländische Studie bei Patientinnen und Patienten mit ischämischen Insulten in der vorderen Strombahn, dass der Nutzen für eine bessere funktionelle Erholung mit funktioneller Unabhängigkeit innerhalb der ersten 24h nach dem Insult erhalten bleibt. Dies namentlich bei Patientinnen und Patienten, bei denen im Computertomogramm ein relevanter Kollateralfluss (und damit besserer Versorgung des Gewebes mit Sauerstoff) nachgewiesen werden konnte (4). Das Zeitfenster für erfolgreiche Interventionen hat sich also signifikant erweitert und auch grosse ischämische Insulte sind keine Kontraindikation per se für eine endovaskuläre Thrombektomie mehr.
1. NEJM 2022, DOI: 10.1056/NEJMoa2118191, 2. NEJM 2023, doi:10.1056/NEJMoa2214403, 3. NEJM 2023, doi:10.1056/NEJMoa2213379, 4. The Lancet 2023, doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00575-5
Therapie rezidivierender Clostridoides difficile Infekte: Ohne Stuhltransplantationen?
Die meisten Episoden einer Clostridoides difficile Infektion sind antibiotisch gut zu behandeln. Allerdings liegt das Risiko eines Rezidivs nach einem Erstinfekt bei etwa 25%. Bei Patientinnen und Patienten mit einem solchen steigt die Wahrscheinlichkeit, weiterer Rezidive auf eindrückliche 60%. Guidelines empfehlen denn auch für diese Hochrisikopatienten eine Wiederherstellung der protektiven Mikrobiomzusammensetzung durch Stuhltransplantate gesunder Spender. Als Alternative kommen nun sogenannte «Biotherapeutika» zur Anwendung, welche die unselektive Mikrobiomtransplantationen durch spezifische, protektive Bakterienstämme (in vitro gezüchtet) ersetzen. Eine solche Studie verwendete 8 kommensale, nicht-pathogene und keine Toxine produzierenden Clostridoidesstämme, welche nach Gabe von Laxativa diesen Hochrisikopatientinnen und -patienten appliziert wurden. Das Rezidivrisiko konnte durch diese Clostridoidesstämme auf mehr als einen Drittel reduziert werden (auf knapp 14% im Vergleich zu den knapp 46% unter Placebo, follow-up = 8 Wochen). Dies sind eindrückliche Daten! Bei Bestätigung dürfte der Weg frei sein für diese innovativen Biotherapeutika. Allerdings ist auch bei ihnen das Rezidivrisiko nicht Null, weshalb weitere Massnahmen oder alternative Zusammensetzungen der Bakterienstämme zu prüfen sind.
JAMA 2023, doi:10.1001/jama.2023.4314, verfasst am 21.04.2023
Senkt Denosumab das Typ 2 Diabetes mellitus Risiko?
Denosumab ist ein antiresorptiv wirkender monoklonaler Antikörper, der ein von Lymphozyten und Osteoblasten gebildetes, zirkulierendes Zytokine (den sog. RANK-Liganden, RANKL*) bindet und auf diesem Wege neutralisiert. Im Knochen führt dies zur Hemmung der Osteoklastenaktivität, also einer antiresorptiven Wirkung. Das angesprochene Zytokin (RANKL) wird auch in der Entzündungskaskade, die die Entwicklung eines Typ 2 Diabetes fördert, inkriminiert. In Übereinstimmung mit dieser Hypothese entwickelten mehr als 4000 Patientinnen und Patienten mit Denosumab Neuverschreibungen signifikant seltener einen Typ 2 Diabetes mellitus als eine 5-fach grössere Kontrollpopulation unter Bisphosphonaten. Und dies über eine Nachbeobachtungszeit von 2,2 Jahren. Die Risikoreduktion betrug etwa einen Drittel. Denosumab könnte also vor allem bei Patientinnen und Patienten mit hohem Risiko für das Auftreten eines Diabetes mellitus (namentlich positive Familienanamnese, BMI > 30 kg/m2) das Antiosteoporose-Mittel der ersten Wahl werden.
BMJ 2023, doi.org/10.1136/bmj-2022-073435, verfasst am 22.04.2023
Hintergrundswissen: kurz zusammengefasst
Guidelines für die COPD neu verfasst (GOLD 2023)
Ursachen, Risikofaktoren und neu definierte diagnostische Kriterien
• Hauptursachen bleiben Tabakkonsum und Inhalationen von Toxinen/Partikeln aus Umwelt- und
Haushaltsverschmutzungen.
• Gestörte Lungenentwicklung und beschleunigtes Lungenaltern verstärken deren Wirkung.
• Genetische Varianten exazerbieren diese Umweltfaktoren. Unter den vielen, in der Effektgrösse eher kleinen Genvarianten ist der Serpina 1 Gendefekt der wichtigste genetische Risikofaktor. Er ist Grund für den alpha-1-Antitrypsin-Mangel.
• Im richtigen klinischen Kontext (Husten, Auswurf, Dyspnoe, Exazerbationen) und typischen Risikofaktoren ist eine spirometrisch nicht völlig reversible Obstruktion oder «Atemflusseinschränkung» diagnostisch für eine COPD (FEV1/FVC* Quotient nach Bronchodilatation < 0.7).
• Einige Individuen haben COPD-kompatible Symptome, allenfalls strukturelle Lungenbefunde (Überblähung, Emphysem) oder andere Lungenfunktionsstörungen wie eingeschränkte Diffusionskapaztiät aber keine irreversible Broncho-Obstruktion
(d.h. FEV1/FVC > 0.7 nach Inhalation eines Bronchodilatators).
• Diese Individuen werden als Prä-COPD oder PRISm (preserved ratio impaired spirometry) klassifiziert. Die Hoffnung ist, bei entsprechenden Interventionen die Entwicklung einer COPD hinauszögern oder gar verhindern zu können.
1. POCKET-GUIDE-GOLD-2023-ver-1.2-17Feb2023_WMV%20(1).pdf Obwohl das Dokument über diesen link via die Gold-Website frei und gratis zugänglich ist, gibt es ein formelles copyright, das uns verbietet, Ihnen das Dokument direkt anzuheften.
*FEV1 = Forciertes Erstsekundenvolumen, FVC = Forcierte Vitalkapazität.
Auch noch aufgefallen
Welches Salz für alte Menschen?
Wenn Sie Patientinnen und Patienten in Alters- oder Pflegeheimen betreuen, könnte diese Arbeit für Sie interessant sein: Die Reduktion des der Nahrung zugegebenen oder in präfabrizierten Nahrungsmitteln wie Brot bereits enthaltenen Kochsalzes (NaCl) kann mit einer allmählichen Reduktion des Salzgehaltes ohne Klagen der Betroffenen erreicht werden, weil sich offensichtlich die Geschmackspräferenzen auch anpassen. In fast 50 Chinesischen Heimen wurde den Kochenden ein teilweiser Ersatz des Kochsalzes (NaCl) durch Kaliumchlorid (KCl) studienmässig vorgeschrieben und mit den Folgen keiner Intervention oder einer isolierten Reduktion des NaCl verglichen, und zwar über eine Beobachtungsdauer von 2 Jahren. Die Resultate sind eindrücklich und mit vielen Studien in anderen Populationen vergleichbar, die einen Nutzen des verminderten Natriums, aber erhöhten Kaliums in der Diät nachwiesen: Eine kombinierte «Salzung» in der Heimküche (62,5% NaCl, 25 % KCl, der Rest organische Salze) verminderte die systolischen und diastolischen Blutdruckwerte und die kardiovaskulären Ereignisse signifikant, aber nicht die Gesamtmortalität. Eine isolierte Reduktion des zugefügten Kochsalzes hatte nur marginale Effekte. Der fehlende Effekt auf die Mortalität – der bei dieser Population naturgemäss nicht mehr das Hauptziel sein dürfte –, aber die positiven Effekte auf die Morbidität sind starke Argumente, Kalium zu Lasten von Natrium in der Diät zu erhöhen. Die Daten wurden übrigens erhoben in einer Population mit ziemlich hohem Kochsalzkonsum ( ca 10. Gramm pro Tag, gemessen durch eine 24h Urinsammlung).
Nature Medicine 2023, doi.org/10.1038/s41591-023-02286-8, verfasst am 24.04.2023
Physiologie und Pathophysiologie
Wie wirken GLP-1 Agonisten?
Die Glukagon-like-Peptid 1 (GLP1) Agonisten (allen voran das Semaglutid) werden in vielen Ländern als Antidiabetika und zur Gewichtsreduktion (z.T. noch sog. «off-label») verwendet. Vor allem der grosse und vor allem auch der anhaltende, reduzierende Effekt auf das Körpergewicht hat im Vergleich zu bisherigen nicht-operativen Gewichtsreduktionen ein neues Kapitel in der Adipositastherapie aufgeschlagen. Darum ist es vielleicht gut, dass Sie sich anhand der nachfolgenden Figur den multiplen Wirkungsmechanismen des Glukagon-like-Peptids und somit seiner Agonisten in Erinnerung rufen.
JAMA 2023, doi:10.1001/jama.2023.2438, verfasst am 27.04.2023
krapf@medinfo-verlag.ch