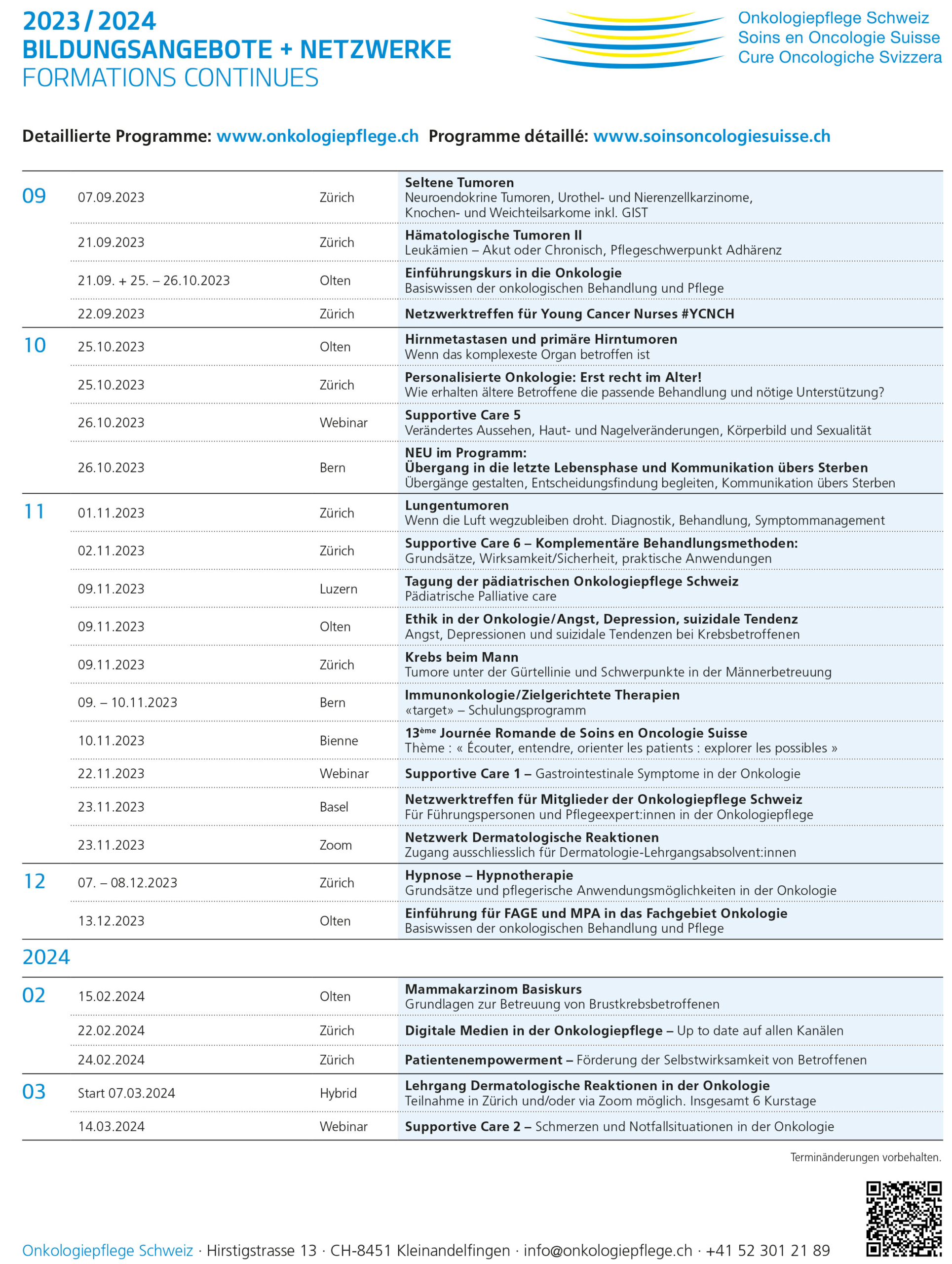- Empathie und Pflege
Vielleicht mag es befremdlich erscheinen, sich mit Empathie und Pflege zu beschäftigen, weil diese Haltung so definitorisch und so selbstverständlich für den Pflegeberuf erscheint. Ein Blick in die Medien oder gängige Krankenhaus-TV-Formate scheint diese Haltung zu bestätigen. Pflegende haben unendlich Zeit, wenden sich mit fürsorglicher Haltung dem Patienten, der Patientin und den Angehörigen zu und wenn es die Situation verlangt, fahren sie zu ihnen nach Hause und versorgen den Hund.
Empathie als Arbeitsinstrument
Pflegenden, die diese Bilder nach einem anspruchsvollen, stressigen Dienst sehen, könnte dies wie ein Hohn erscheinen. «Wissen Sie, was hier los ist? Für Empathie und Zuwendung haben wir leider keine Zeit», waren Rückmeldungen, die wir von vielen Pflegenden in Projekten erhalten haben. Dabei ist eine Gesundheitsversorgung ohne Empathie eigentlich nur sehr schwer vorstellbar. Empathie ist eine wichtige Voraussetzung und zugleich ein zentrales Arbeitsinstrument für Caring-Berufe. Sie ermöglicht es erst, Bedürfnisse und Gefühle anderer Menschen zu erschliessen, um daran das Handeln auszurichten.
Empathie als Alltagskommunikation
Die «Selbstverständlichkeit» von Empathie mag sich auch aus deren breitem Einzug in den Alltag unserer Gesellschaft ergeben haben. Bücher, Ratgeber und Seminare rund um Empathie werden rege nachgefragt. Auch in der alltäglichen Kommunikation finden sich häufig Beschreibungen von Personen als «empathisch», oder Krisen wie die der Corona-Pandemie werden in den Medien eine «empathische Kraft» zugeschrieben, die die Gesellschaft enger zusammenführen würden. Typischerweise wird bei diesen Aussagen nicht näher ausgeführt, was unter Empathie genau zu verstehen sei. Es macht den Anschein, als verstehe sich Empathie in der Alltagskommunikation vermeintlich von selbst (Thiry, Kocks et al., 2021), was auch für die Pflege gilt, wie ein Blick in gängige Pflegelehrbücher oder Ausbildungscurricula zeigt.
Empathie – ein Versuch der begrifflichen Näherung
Was ist nun genau unter Empathie zu verstehen? Häufig werden emotionale Zustände und prosoziale Verhaltensweisen im Alltag als empathisch bezeichnet. Auch wenn in der wissenschaftlichen Psychologie ein breites, teilweise sehr heterogenes Verständnis von Empathie zu finden ist, so lassen sich doch einige charakteristische Aspekte ausmachen. Empathie ist durch das Zusammenspiel von affektiven Aspekten und kognitiven Komponenten gekennzeichnet. Die kognitive Komponente umfasst das intellektuelle Nachvollziehen der Situation einer anderen Person. Dadurch wird es uns möglich, eine andere Person hinsichtlich ihrer Emotionen und Gedanken zu verstehen. Demgegenüber beschreibt die affektive Komponente der Empathie, dass die Emotionen eines Gegenübers geteilt bzw. miterlebt werden. Deutlich wird dies beispielsweise an der «Gefühlsansteckung», in denen sich Emotionen, die sich beispielsweise in Weinen oder Lachen zeigen, mehr oder weniger ohne willentliche Steuerung auf eine andere Person übertragen. Dabei passen sich Gestik, Mimik und Körperhaltung des Gegenübers an, was als eine Art emotionale Spiegelung verstanden werden kann (Iacoboni und Mazzotta 2007). Die Fähigkeit, zwischen den eigenen Emotionen und denen des Gegenübers zu unterscheiden, wird in der Psychologie mit der Selbst-Andere-Differenzierung (Lamm et al 2007) beschrieben. Empathie wird in der Regel definiert als die Fähigkeit, die emotionale Situation eines anderen Menschen zu erkennen, zu verstehen und mitzufühlen. Dabei muss zugleich ein Bewusstsein dafür bestehen, dass die mitgefühlten Emotionen empathisch übertragen sind, also ihr Ursprung in der anderen Person liegt (nach Roth und Altmann in Thiry, Kocks et al., 2021).
Die dunkle Seite der Empathie
Freilich erscheint Empathie erst einmal als eine uneingeschränkt zu bejahende Fähigkeit des Menschen, welche zu moralisch richtigem und prosozialem Verhalten führt. Der klare Zusammenhang von empathischen Empfindungen und altruistischem Verhalten (z. B. Mitgefühl, Wärme, Fürsorge etc.) dürfte für diese Zuschreibung verantwortlich sein. Die Empfindung von Empathie gegenüber leidenden Personen begünstigt demnach die Motivation, zu helfen. Diese gute Seite der Empathie soll hier nicht bestritten werden, und doch müssen wir uns von möglicherweise überhöhten Zuschreibung der Empathie verabschieden. Neben den positiven Auswirkungen von Empathie verweisen einige Befunde der psychologischen Forschung auch auf eine Kehrseite. So konnten beispielsweise Zusammenhänge zwischen erhöhter Empathie und dem vermehrten Auftreten von depressiven Verstimmungen (O`Conner et al., 2007) wie auch Erschöpfungssymptomen (z. B. Williams et al., 2017) aufgezeigt werden. Dabei kann vermutet werden, dass nicht die empathische Emotion an sich negative Auswirkungen hat, sondern vielmehr der Umgang mit dem eigenen empathischen Erleben (Altman und Roth 2014). Nach diesen Überlegungen sind insbesondere Personen bzw. Berufsgruppen als «Risikogruppen» anzusehen, die häufig und mit intensiven empathischen Anforderungen, wie sie eben in der Pflege anzutreffen sind, konfrontiert werden.
Empathie und Pflege
Seit Florence Nightingale werden Mitgefühl, Empathie und Interaktion als wesentliche und unverzichtbare Elemente der Pflege-Patientenbeziehung beschrieben und finden Niederschlag in relevanten Pflegetheorien (z. B. Peplau 1952, Nightingale 1859). Pflege findet in der Regel im intensiven Austausch in teilweise sehr persönlichen Situationen mit anderen Personen statt. Dies bedingt die zwangsweise Auseinandersetzung mit intensiven Bedürfnissen und Gefühlen. Hoffnung, Wut, Enttäuschung, Glück – Pflegende können sich dieser Auseinandersetzung nicht entziehen. Hinzu kommt, dass Pflegende selbst mit ihren eigenen Bedürfnissen und ihren (situativen) Gefühlen in die Pflegearbeit gehen. Pflegende sind nicht neutral, auch wenn der Anspruch der Kontrolle, der eigenen Gefühle im Sinne der Service-Arbeit in der Pflegepraxis einen großen Raum einnimmt. Spezifisch für die Pflege ist dabei, dass ihr neben der verbalen und der nonverbalen Kommunikation insbesondere über die Körperarbeit eine weitere wesentliche Kommunikationsmöglichkeit zur Verfügung steht. Kommunikation ist die grundlegende Bedingung für alle notwendigen Aushandlungsprozesse und Vertrauensbildung in der Pflegearbeit. Ohne Empathie, ohne das Hineinversetzen in das Erleben und die Bedürfnisse des Gegenübers ist diese Gesundheitsversorgung nur schwer möglich. Empathie ist demnach als notwendiges Arbeitsinstrument der Pflege zu verstehen.
Empathie: Pflege für sich und andere
Welche Schlussfolgerungen lassen sich nun für die Pflege ableiten? Caring-Berufe sind empathische Berufe. Die Fähigkeit, sich in Situationen und Bedürfnisse anderer Personen hineinzuversetzen, ist die Voraussetzung für gelingende Interaktionsarbeit und notwendige Aushandlungsprozesse. Für Pflegende ist es zentral, sich selbst dabei nicht zu vergessen, sondern die Bedürfnisse des Gegenübers und die eigenen Bedürfnisse in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Dies darf nicht zu der vereinfachten Schlussfolgerung drängen, Pflegende sollten lernen, empathisch Nein zu sagen. Vielmehr geht es darum, Gefühle und Bedürfnisse beim Gegenüber und bei sich selbst zu entdecken und anzusprechen. Dies ist die Basis für die gemeinsame Suche nach Lösungsmöglichkeiten. Anregung und Orientierung können hierzu sogenannte Gefühle- und Bedürfnislisten im Internet geben, denn interessanterweise fällt es uns nicht leicht, über diese zu sprechen. Gleichzeitig möchte ich Pflegende auch zur Selbstempathie, Selfcare und Teamcare ermutigen. Was finden Sie schön? Was spendet Ihnen Kraft oder tut Ihnen gut? Manchmal sind dies sehr kleine alltägliche Dinge wie die Tasse Kaffee am Morgen oder die Sonnenstrahlen am Fenster. Diese bewusst und vor dem Hintergrund der Bedürfnisbefriedigung genossen, sind eine wunderbare Kraftquelle, die uns und dem Gegenüber guttut.
Andreas Kocks; BScN, MScN
Pflegewissenschaftler Universitätsklinikum Bonn Sprecher im Netzwerk Pflegewissenschaft und Praxisentwicklung der Universitätsklinika in Deutschland
Mitentwickler des empathischen Entlastungskonzeptes empCARE
Erstpublikation des Artikels in der Zeitschrift Onkologiepflege 1/2023
Iacoboni M, Mazziotta JV (2007): The mirror neuron system and the consequences of its dysfunction, Nat Rev Neurosci, 7(12):942-51
Lamm C, Batson CD, Decety J (2007) The neural substrate of human empathy: effects of perspective-taking and cognitive appraisal, J Cogn Neuroscim (1):42-58
Nightingal F (1859): Notes on nursing, what it is und what it is not, J.B. Lippincott Company, London
Peplau HE (1952): Interpersonal Relations In Nursing: A Conceptual Frame of Reference for Psychodynamic Nursing, Putnam, New York
Thiry, L, Schönefeld V, Deckers M, Kocks A (2021): empcare, ein Arbeitsbuch zur empathiebasierten Entlastung in Pflege und Gesundheitsberufen, Springer, Heidelberg