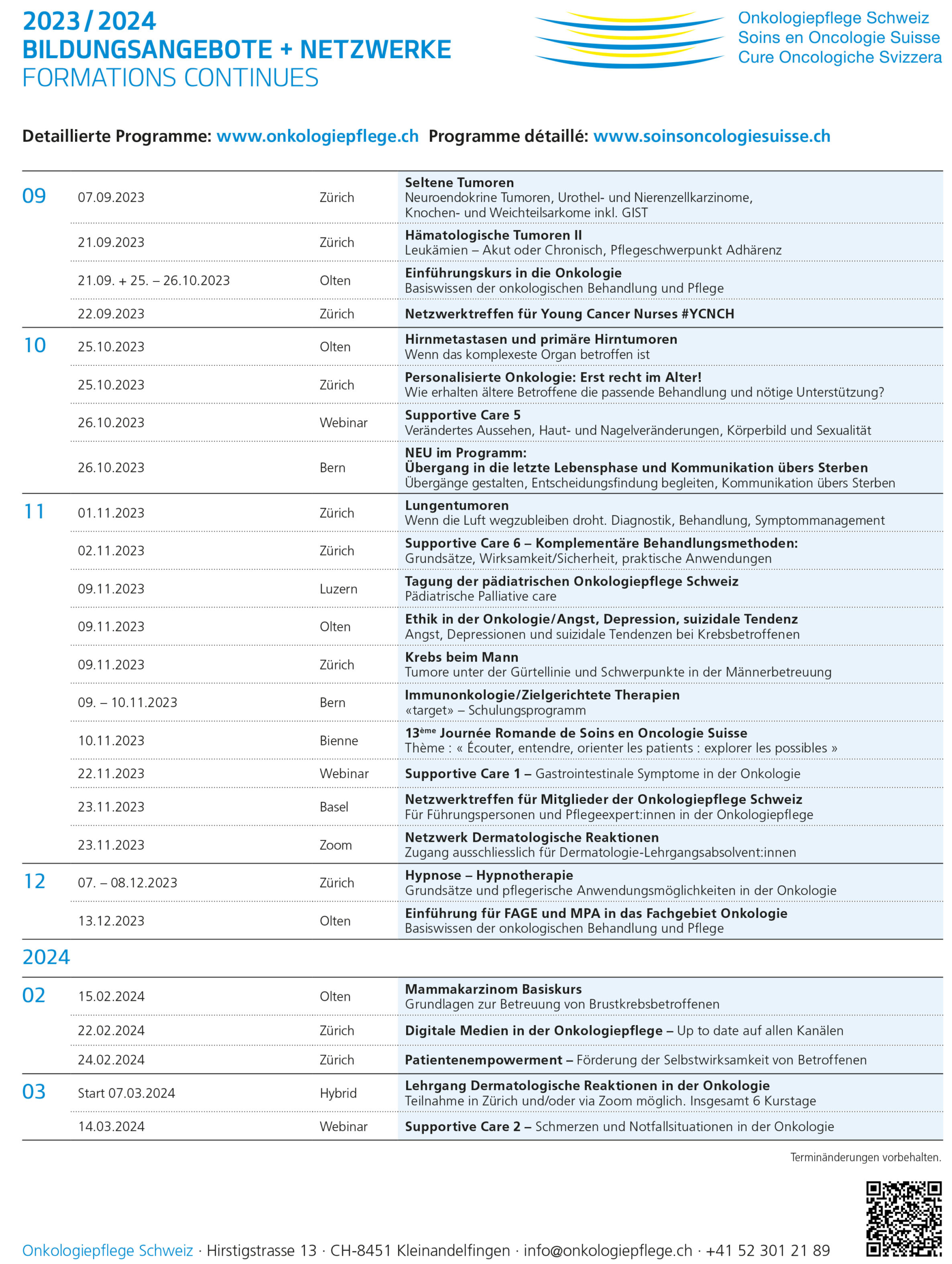- Krebsbedingte finanzielle Not
Studien zeigen, dass fast die Hälfte aller Cancer Survivors unter finanziellen Problemen leidet. Fehlendes Bewusstsein und Hemmschwellen hindern jedoch sowohl Betroffene als auch Fachpersonen daran, das Thema anzusprechen. Der vorliegende Artikel berichtet über einen forschungsbasiert entwickelten Betreuungsstandard für die onkologische Praxis und dessen Testung in zwei Spitälern.
Ausgangslage
Eine Krebserkrankung verursacht direkte und indirekte Kosten. Zu den direkten Kosten zählen medizinische (z. B. Medikamente) und nicht-medizinische Kosten (z. B. Kosten für eine Haushaltshilfe). Einen weitaus grösseren Einfluss auf die wirtschaftliche Gesamtsituation von Betroffenen und Angehörigen haben jedoch die indirekten Kosten. Diese entstehen beispielsweise, wenn Betroffene aufgrund der Krankheit das Arbeitspensum reduzieren müssen oder gar den Job verlieren (Fitch et al., 2021; Lueckmann et al., 2020).
Finanzielle Sorgen haben wiederum vielfältige Auswirkungen auf Krebserkrankte und Angehörige. Sie stehen in Zusammenhang mit emotionaler Belastung sowie mit einer geringeren Lebensqualität und können den Gesundheitszustand der Betroffenen langfristig massiv beeinträchtigen (Gordon et al., 2017; Smith et al., 2019).
Studien legen eindrücklich dar, dass es sich bei der Entstehung von krebsbedingten finanziellen Notlagen um einen zirkulären und komplexen Prozess handelt. (Fitch et al., 2021; Scheidegger et al., 2022). Problematisch ist insbesondere, dass diese von allen Beteiligten oft zu spät erkannt oder unterschätzt werden. In der Phase der Diagnostik und Therapie steht das Überleben im Vordergrund – für finanzielle Angelegenheiten bleibt kaum Kapazität (Kobleder et al., 2020). Die Thematik ist zudem meist nicht Bestandteil des routinemässigen Assessments und der Interaktion mit Fachpersonen. Es zeigt sich, dass das Ansprechen von finanziellen Angelegenheiten mit einer Hemmschwelle verbunden ist. Schamgefühle und der Druck, die bestmögliche Behandlung zu erhalten, können dazu führen, dass einige Patientinnen und Patienten das Thema Geld in der Interaktion mit Fachpersonen nicht ansprechen möchten (Thomas et al., 2019). Bei anderen Patientinnen bzw. Patienten kann es wiederum Frustration auslösen, wenn Fachpersonen nicht mit ihnen über finanzielle Angelegenheiten sprechen (Yeager, 2021). Wallace et al. (2015) zeigen, dass Gespräche über die Arbeitssituation sowie über finanzielle Angelegenheiten zu den Themen gehören, die Onkologiepflegefachpersonen am wenigsten mit Pa-tientinnen und Patienten diskutieren. Fast die Hälfte der befragten Pflegefachpersonen erachtete solche Gespräche nicht als Teil ihrer Rolle.
In der Schweiz fehlt es an konkreten, aktuellen Daten zu den finanziellen Auswirkungen einer Krebserkrankung. Zudem fehlen in der onkologischen Versorgung Richtlinien, klare Zuständigkeiten und Hilfsmittel, um finanzielle Probleme in der Interaktion mit Betroffenen und Angehörigen frühzeitig zu erkennen und anzusprechen. Ziel unseres Forschungsprojekts war es deshalb,
1. den komplexen Entstehungsprozess von krebsbedingten finanziellen Problemen erstmals in der Schweiz zu untersuchen und zu visualisieren.
2. einen Betreuungsstandard inkl. Screening Instrument zu entwickeln, der Pflegefachpersonen und Onkologinnen bzw. Onkologen über finanzielle und soziale Risiken einer Krebserkrankung informiert und sie dabei unterstützt, das Thema im Praxisalltag anzusprechen, entsprechende Risiken zu erkennen und frühzeitig entsprechende Massnahmen einzuleiten.
3. die Anwendung des Betreuungsstandards in der onkologischen Praxis zu testen.
Vorgehensweise im Projekt
Analog zu den Teilzielen beinhaltete die Projektdurchführung drei Teilschritte, die nachfolgend dargestellt werden. Ein wesentliches Merkmal des Projekts war der Austausch mit Expertinnen und Experten aus der Sozialen Arbeit. Dieser fand über alle Teilschritte hinweg statt.
Der Betreuungsstandard
Als Anwenderzielgruppe des entwickelten Betreuungsstandards gelten Pflegefachpersonen sowie Onkologinnen und Onkologen im stationären und ambulanten Setting. Der Betreuungsstandard unterstützt sie bei der Vorbereitung von Gesprächen über die sozioökonomischen Auswirkungen der Krebserkrankung gemeinsam mit Betroffenen. Neben Hintergrundinformationen zur Thematik bildet das Screening-Instrument den Hauptbestandteil des Standards. Dieses dient der Früherkennung von Risikopersonen sowie der frühzeitigen Involvierung der Sozialberatung. Das Screening kann zu verschiedenen Zeitpunkten zum Einsatz kommen: nach der Diagnosestellung, zu Beginn der Behandlung, als Follow-up während der laufenden Therapie und Betreuung sowie zum Abschluss der Behandlung. Der Zeitpunkt für das Follow-up liegt im Ermessen der Gesundheitsfachperson.
Das Screening Instrument besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beinhaltet sechs Fragen aus dem Distress-Thermometer zu den praktischen Problemen (Wohnsituation, Kinderbetreuung usw.). Im zweiten Teil befinden sich gezielte Fragen zu den identifizierten Hauptrisikofaktoren für krebsbedingte finanzielle Probleme (z. B. ob Unterstützung des sozialen Umfeldes vorhanden ist oder ob berufliche bzw. private Verpflichtungen je nach Gesundheitszustand angepasst werden können). Aus der Beantwortung aller Fragen resultiert ein Punktetotal, welche die Zuteilung zu drei Handlungsempfehlungen (Sozialberatung indiziert/empfohlen/ derzeit nicht erforderlich) erlauben.
Erkenntnisse aus der Pilotierung
In den zwei teilnehmenden Spitälern führten sechs Pflegefachpersonen die Testung des Betreuungsstandards bei 64 Patientinnen bzw. Patienten durch. Häufigste Gründe für eine nicht-Teilnahme waren die Ablehnung der Patientin bzw. des Patienten, eine Sprachbarriere oder die Patientin bzw. der Patient wurde verpasst. Das Durchschnittsalter der Patientinnen bzw. der Patienten betrug 66 Jahre (Spannweite 30-86 Jahre), davon waren 67 % männlich und 33 % weiblich. Bei 53 % der Teilnehmenden war eine Sozialberatung indiziert bzw. empfohlen worden.
In den Fokusgruppen wurde berichtet, dass das Instrument beim 2. Chemotherapiezyklus zur Anwendung kam (ca. drei bis vier Wochen nach Diagnosestellung). Dies wurde damit begründet, dass der Fokus zu Beginn auf der Erkrankung und auf den Symptomen liege und keine Zeit bleibe, sich über die Kosten Gedanken zu machen. Oftmals erfolge der Start der Chemotherapie unmittelbar nach der Diagnose.
Der Betreuungsstandard wurde von den Pflegefachpersonen als sinnvolle Erweiterung des Distress-Thermometers wahrgenommen. «Ich finde, es ist auch ein wenig augenöffnend. Es macht einen auf Themen aufmerksam, die man vielleicht jetzt im ersten Moment gar nicht so vor sich hat. (Pflegefachperson FG1)» Die Pflegefachpersonen berichteten davon, dass das Dokument zur Senkung der Hemmschwelle beitrug, um das Thema Finanzen anzusprechen. Viele Patientinnen und Patienten hätten sich zuvor noch keine Gedanken dazu gemacht und das Screening war für sie ein Angebot (jedoch kein Muss), über das Thema zu sprechen. Die Pflegefachpersonen empfanden die Atmosphäre während des Gesprächs als offen und entspannt und sie erlebten kaum Ablehnung von Seiten der Patientinnen und Patienten. Das Screening Instrument vermittelte den Fachpersonen Sicherheit, da weitere Handlungsschritte klar aufgeführt waren. Wenn das Screening im Pflegealltag integriert werden konnte, verursachte es keinen nennenswerten Mehraufwand, lieferte aber einen deutlichen Mehrwert. Eine mehrmalige Anwendung des Screening-Instruments (z. B. auch nach Behandlungsabschluss) wurde als sinnvoll erachtet.
Insbesondere im Ambulatorium wurde es als herausfordernd beschrieben, die Patientinnen und Patienten zu «erwischen» bei den vielen anderen Terminen, die diese wahrnehmen mussten. Zudem wurde die mangelnde Privatsphäre als hinderlich empfunden, um dieses sensible Thema zu besprechen. Darüber hinaus erlebten die Pflegefachpersonen die Einstiegsfrage in den zweiten Teil des Screenings als zu konfrontierend («Ich weiss, dass im Zusammenhang mit meiner Krebserkrankung Kosten auf mich zukommen können, die nicht von einer Versicherung gedeckt werden.») Diese wurde deshalb nach der Testphase umformuliert. Abschliessend gilt es darauf hinzuweisen, dass individuelle Entscheidungen zur Notwendigkeit der Handlungsempfehlungen zulässig sind. Diese sollten jedoch auf dem Screening-Instrument schriftlich festgehalten werden.
Es wurden verschiedene Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Betreuungsstandards genannt:
► Verfügbarkeit in anderen Sprachen
► elektronische Verknüpfung mit dem Distress-Thermometer
► Erarbeitung einer Version, die den Patientinnen und Patienten abgegeben wird: Screening Instrument und eine kurze Zusammenfassung von Hintergrundinformationen
► Schulung der Pflegefachpersonen zum Thema Finanzen/Versicherungen inklusive Abgrenzung des Zuständigkeitsbereichs
Fazit
Die folgenschweren Auswirkungen von krebsbedingten finanziellen Problemen wurden in zahlreichen Studien hinreichend dargelegt. Trotzdem werden finanzielle Angelegenheiten sowohl von Fachpersonen als auch von Patientinnen bzw. Patienten nach wie vor zu wenig bis gar nicht angesprochen. Der erläuterte Betreuungsstandard liefert eine niederschwellige und effiziente Möglichkeit, um die Thematik als festen Bestandteil in der onkologischen Pflegepraxis zu verankern.
Das Projekt «Gesundheitsrisiko Geld – Sozioökonomische Auswirkungen einer Krebserkrankung» wurde von der Krebsliga Schweiz finanziell unterstützt und befindet sich in der Abschlussphase. Derzeit arbeiten wir an einer Disseminationsstrategie, um den Betreuungsstandard inkl. Screening-Instrument interessierten Fachpersonen zugänglich zu machen und sie bei der Implementierung in ihren jeweiligen Settings zu unterstützen.
Daniela Bernhardsgrütter, MScN
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Prof. Dr. Andrea Kobleder
Co-Leiterin Kompetenzzentrum OnkOs & Studienleiterin MAS Palliative C
Institut für Angewandte Pflegewissenschaft
OST – Ostschweizer Fachhochschule
St. Gallen
Fitch, M. I., Sharp, L., Hanly, P. & Longo, C. J. (2021). Experiencing financial toxicity associated with cancer in publicly funded healthcare systems: a systematic review of qualitative studies. J Cancer Surviv. doi:10.1007/s11764-021-01025-7
Kobleder, A., Richle, E. & Müller, M. (2020). Gesundheitsrisiko Geld – Sozioökonomische Auswirkungen einer Krebserkrankung. Pflegerecht, (3), 138-143.
Lueckmann, S. L., Schumann, N., Hoffmann, L., Roick, J., Kowalski, C., Dragano, N. & Richter, M. (2020). ‘It was a big monetary cut’ – A qualitative study on financial toxicity analysing patients’ experiences with cancer costs in Germany. Health & social care in the community, 28(3), 771-780. doi:10.1111/hsc.12907
Scheidegger, A., Bernhardsgrütter, D., Kobleder, A., Müller, M., Nestor, K., Richle, E. & Baum, E. (2022). Financial Toxicity among Cancer-Survivors: A Conceptual Model Based on a Feedback Perspective. Research Square; 2022. doi:10.21203/rs.3.rs-2377201/v1
Thomas, T., Hughes, T., Mady, L. & Belcher, S. M. (2019). Financial Toxicity: A Review of the Literature and Nursing Opportunities. Clinical Journal of Oncology Nursing, 23(5), 5-13. doi:10.1188/19.CJON.S2.5-13.