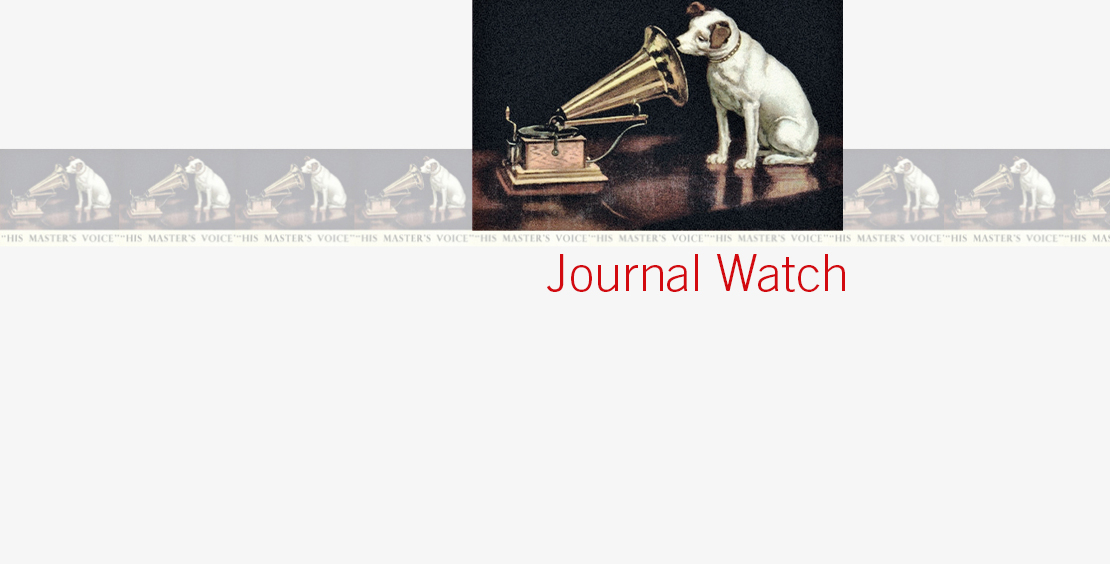- RETO KRAPFs Medical Voice
Frisch ab Presse:
GLP-1-Rezeptoragonisten: Induzieren sie eine Sarkopenie oder Osteopenie?
Reinrassige GLP-1-Rezeptoragonisten wie Semaglutid sowie auch hybride Agonisten (GLP-1-Rezeptor und GIP für «glucose-dependent insulinotropic peptide») induzieren eine sehr grosse Gewichtsabnahme (minus 15-20% nach 1-2 Jahren) bei Adipositas. Beim Absetzen nimmt das Körpergewicht aber ebenso verlässlich wieder zu. Neuere Daten zeigen, dass das sogenannte Magergewicht («lean body mass») mehr abnimmt als die Fettmasse und im Falle des Absetzens die Fettmasse disproportional zunimmt. In beiden Fällen werden vor allem die Muskel- und Knochenmassen reduziert, was vor allem bei Zuständen oder Risikofaktoren für eine Sarkopenie und Osteopenie nachteilig ist. Angeblich soll ein neuer Tripelagonist (GLP1-Rezeptor-und GIP-Agonist sowie Glukagon, Retratutid) diesen Effekt nicht oder weniger ausgeprägt haben. Mit DXA-Messungen könnte man diese Effekte, falls eine sogenannte Baseline-Untersuchung vorliegt, bestimmen. Allerdings gibt es ausser dem Absetzen dann keine gute Interventionsmöglichkeit. Zu klären ist auch, durch welchen Gewebetyp die Gewichtszunahme nach Absetzen dieser Medikamente erfolgt. Sollte es wirklich vorwiegend die Fettmasse allein sein, wären das keine guten Nachrichten.
JAMA 2023, doi:10.1001/jama.2023.23141, verfasst am 08.12.2023
Eine positive Nachricht
Genomische Sequenzen von 500’000 Menschen der biomedizinischen Forschung zugänglich gemacht
Wir haben hier schon mehrmals über wertvolle Beobachtungen durch Analyse von Daten in der UK (United Kingdom) Biobank, der grössten weltweit, berichtet. Es handelt sich dabei um eine Schatztruhe von umfassenden biologischen, genomischen und Gesundheits-Daten von mittlerweile etwa 500 000 Britinnen und Briten. Nun können die Daten der mehr oder minder vollständigen Genome dieser 500’000 Individuen für Forschungszwecke auf Antrag weltweit analysiert werden. Unter dem Genom versteht man alle sogenannten Exone (d.h. in Eiweisse übersetzte Genabschnitte) und Introne (die auf multiple Weise die Transskriptionsart und -häufigkeiten der Exone regulieren, selber aber nicht abgelesen, respektive übersetzt werden). Insofern die britische Genombasis auch für eine Schweizer Population repräsentativ ist, kann man aus dieser Datenbasis enorm viele Informationen über genomische Krankheitsursachen oder Modulationen und vieles andere mehr lernen.
Nature 2023, doi.org/10.1038/d41586-023-03763-, verfasst am 08.12.2023
Unkomplizierte Cholezystolithiasis: Laparaskopisch operieren oder zuwarten?
In der Regel sind die klinischen Lehrmeinungen bei unkomplizierter Cholezystolithiasis gemacht: Laparaskopisch operieren, falls symptomatisch (typische Gallekolik, >30 Minuten Dauer). Bei asymptomatischer Cholezystolithiasis jedoch soll man konservativ vorgehen. Eine aktuelle Studie hinterfragt aber das invasive Vorgehen bei unkomplizierter, symptomatischer Cholezystolithiasis, zumindest für die ersten 18 Monate (Beobachtungszeit der Studie) nach dem Erstereignis: Die Lebensqualität und die Schmerzepisoden, respektive Schmerzintensität waren nicht signifikant unterschiedlich, allerdings verbunden mit signifikant tieferen Kosten in der konservativen Gruppe (1). Warum sind Schmerzepisoden gleich häufig oder gleich intensiv? Das ist nicht so klar, aber vielleicht ist erinnerungswürdig, dass bis zu 40% der Patientinnen und Patienten nach einer Cholecystektomie weiterhin relevante Schmerzen aufweisen (2). Ebenfalls ist bedenkenswert, dass bei unkomplizierter, aber symptomatischer Cholezystolithiasis die jährlichen Komplikationsraten (Cholecystitis, Cholangitis, Pankreatitis uam) mit 1-3% ziemlich tief sind, also kein «Druck» oder «Muss» auf ein baldiges operatives Vorgehen besteht (3). Interessiert warten wir auf die Befunde nach 18 Monaten, inklusive die Entwicklung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.
1. BMJ 2023, https://doi.org/10.1136/bmj-2023-075383,
2. Br J Surg 2016, doi:10.1002/bjs.10287 pmid:27561954,
3. Siehe: BMJ 2001, doi:10.1136/bmj.322.7278.91 pmid:11154626 sowie Journal of Clinical Epidemiology 1989 https://doi.org/10.1016/0895-4356(89)90086-3 und Ann Int Med 1984, doi:10.7326/0003-4819-101-2-171 pmid:6742647, verfasst am 09.12.2023
Auch noch aufgefallen
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom) und somatische Erkrankungen
Das ADHS ist die häufigste neurologische Entwicklungsstörung und soll – mit steigender Tendenz – in etwa 6 % aller Kinder vorkommen. Das Syndrom umfasst Aufmerksamkeitsdefizite und/oder Hyperaktivität oder Impulsivität, die länger als die für das gegebene Alter normale Dauer persistieren (1). Schon lang fielen Assoziationen mit somatischen Erkrankungen auf, was nun in dieser longitudinalen Studie erhärtet wurde: Bei ADHS-Kindern sind oder werden im Verlauf Adipositas, Karies und (nicht willentlich induzierte) Verletzungen häufiger. Umgekehrt fand die Studie, dass bei Kindern mit Verletzungen (ebenfalls nicht willentlich) und sog. «restless legs» Symptomen ein ADHS deutlich wahrscheinlicher ist oder wird (2). Diese Beobachtungen scheinen wichtig für die pädiatrische Grundversorgung: Bei den genannten Symptomen also an ein ADHS denken und umgekehrt (2)!
1. The Lancet Child and Adolescent Health 2023, doi.org/10.1016/S2352-4642(23)00286-9, 2. The Lancet Child and Adolescent Health 2023, doi.org/10.1016/S2352-4642(23)00226-2, verfasst am 03.12.2023
In weniger als einer halben Minute
Hintergrundswissen zu Hunden und Demenzentwicklung
• Die Nachfrage nach Hunden ist in der Schweiz ungebrochen und führte zu einer Preisexplosion bei Junghunden und – bedenklich – dem Import von sehr jungen Welpen aus dem Ausland.
• Während den (bisherigen) Covid-19 Wellen war Umfragen gemäss die subjektive Lebensqualität bei den Hundehalterinnen und -haltern höher.
• Unabhängig von anderen sozialen und sozioökonomischen Faktoren, war die Hundehaltung mit einer prospektiv 40 % niedrigeren Rate assoziiert, eine Demenz zu entwickeln.
• Die Hunderasse spielte dabei keine Rolle.
• Katzen hatten auf die Demenzentwicklung keinen bremsenden Effekt.
• Die Autoren liegen wohl richtig in der Annahme, dass der Demenz-hemmende Effekt zu einem Grossteil mit dem durch eine (korrekte) Hundehaltung verlangten Lebensstil zusammenhängt.
• Das Gleiche gilt wohl für weitere humane Gesundheitsvorteile durch Hundehaltung, wie in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
• Die Frage bleibt, unter anderen, ob Hunde selber negative Folgen für diese gesundheitsfördernde Dienstleistung erleiden könnten.
• Da Hunde eine Tendenz haben, ihre «Meister» zu imitieren, wäre dies eine interessante Studienfrage, z.B. für Hundehaltung bei menschlichen depressiven oder Burnout-Syndromen.
BMJ 2023, doi.org/10.1136/bmj.p2852, verfasst am 03.12.2023
Welche Diagnose stellen Sie?
Eine 45-jährige Frau fühlt sich seit etwa 6 Monaten nicht mehr fit und beklagt eine vermehrte «Schwermütigkeit». Ihnen fallen eine Rubeosis facei und Striae auf der Bauchhaut von mehr als 1 cm Durchmesser in der Breite auf. Der Blutdruck ist neuerdings erhöht (150/91 mmHg), eine Gewichtszunahme ist nicht eruierbar. Sie vermuten ein Cushing-Syndrom, welches sich durch massiv erhöhte Cortisol-Ausscheidung (24h Urin) und ein erhöhtes Speichelkortisol (um Mitternacht) weitgehend bestätigt. Ihnen fällt aber auch eine Plasmakalium-Konzentration von 2,3 mmol/L auf.
Welche Krankheit bedingt am ehesten das Cushing-Syndrom bei Ihrer Patientin?
A. Cortisol-produzierendes Nebennierenrindenadenom
B. Cortisol-produzierende bilaterale Hyperplasie der Nebennierenrinden
C. Kleinzelliges Bronchuskarzinom
D. ACTH-produzierendes Adenom des Hypophysenvorderlappens (Morbus Cushing)
E. Betamethason-Zufuhr in einem zur Immunstimulation im Internet erhältlichen, dürftig deklarierten Präparat
Antwort:
Exogene Zufuhr (verordnet oder nicht deklariert) von synthetischen Glukortikoiden, supprimiert die endogene Cortisol-Produktion. Ihre Befunde der erhöhten Cortisolkonzentration schliessen diese Diagnose also aus. Cortisol-produzierende Adenome oder Hyperplasien der Nebennierenrinden verursachen in aller Regel keine Hypokaliämie, zumindest keine so ausgeprägte wie hier. Es muss sich also um einen ACTH-produzierenden Prozess handeln. ACTH stimuliert und erhöht das Aldosteron, wodurch ein renaler Kaliumverlust entsteht. Die kurze Anamnese bei dieser typischerweise prämenopausalen Frau spricht für eine paraneoplastische ACTH Produktion, im vorliegenden Fall im Rahmen eines neu diagnostizierten kleinzelligen Bronchuskarzinoms. Bei dieser Krankheit können enorm hohe ACTH Sekretionsmengen beobachtet werden, eine schwere Osteoporose kann in kurzer Zeit auftreten (nicht in diesem Fall, allerdings). Die richtige Antwort ist also Antwort C.
The Lancet 2023, doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01961-X, verfasst am 09.12.2023
krapf@medinfo-verlag.ch