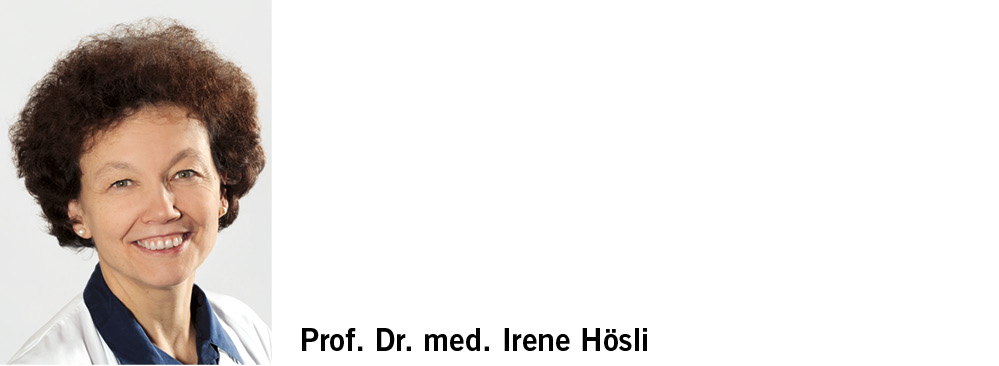- Risikoadaptiertes Screening bei Gestationsdiabetes?
Prof. Dr. med. Irene Hösli absolvierte ihr Medizinstudium an den Universitäten Mainz, Freiburg und Tübingen sowie Basel. Sie spezialisierte sich innerhalb der Geburtshilfe und Gynäkologie auf feto-maternale Medizin. Sie ist emeritierte Extra-ordinaria für Geburtshilfe und leitete die Geburtshilfe und Schwangerschaftsmedizin als Chefärztin an der Frauenklinik des Universitätsspitals Basel. Als Mitglied der Arbeitsgruppe feto-maternale Medizin war sie Mitautorin der Schweizer Empfehlungen zur Versorgung von Frühgeborenen an der Grenze der Lebensfähigkeit zwischen 22. und 26. Schwangerschaftswochen. Sie ist Mitglied der Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz, der Qualitätssicherungskommission der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und Ko-Präsidentin der Schweizerischen Arbeitsgruppe für perinatale Pharmakologie. Sie engagiert sich zudem für Projekte in Rumänien, Moldawien, Litauen und Tansania mit dem Ziel die perinatale Versorgung und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen zu verbessern.
Ehm: Was sind die Hauptunterschiede zum Expertenbrief «Screening Gestationsdiabetes» von 2011?
Hösli: 2011 haben wir uns auf das Screening fokussiert. Wir waren damals eine der ersten Fachgesellschaften im deutschsprachigen Raum, die die Kriterien der HAPO Studie (75 g oGTT) übernommen hat. Im neuen Expertenbrief, der viel ausführlicher ist, haben wir zusätzlich das klinische Management während Schwangerschaft, Geburt und postpartal aufgenommen. Wir haben bewusst versucht, sehr praxistaugliche Empfehlungen abzugeben. Da der GDM zur häufigsten endokrinologischen Erkrankung in der Schwangerschaft geworden ist, arbeiten wir eng mit den Endokrinologen zusammen. Dies zeigt sich auch im neuen Expertenbrief, der interprofessionell erstellt wurde und bei dem 6 von 15 Autor/-innen Endokrinologen sind.
Ehm: Welches sind die neuen Erkenntnisse, die in den neuen Expertenbrief eingeflossen sind?
Hösli: Seit 2011 haben die Risikofaktoren für die Entwicklung eines DM zugenommen. Deshalb haben wir den Abschnitt «Frühes Screening auf einen vorbestehenden DM» aufgenommen. Ausserdem haben wir spezielle Situationen wie Status nach bariatrischen Eingriffen, die ebenfalls zugenommen haben im Expertenbrief beschrieben.
Zum Screening-Verfahren, das mit dem einzeitigen 75 g oGTT aufwendig ist, gibt es neuere Arbeiten, die wieder auf ein zweizeitiges Verfahren (zuerst 50 g Glc und bei Auffälligkeit im zweiten Schritt ein 75 g oGTT) zurückgegangen sind.
Die Ergebnisse des Langzeitoutcomes bei Jugendlichen, deren Mütter bei der HAPO Studie teilgenommen hatten, haben wir ebenfalls als Argument für das einzeitige Vorgehen aufgenommen.
Ehm: Hat die Bedeutung der Erkennung und Therapie des GDM zugenommen?
Hösli: Ja eindeutig. Die Risikofaktoren wie Adipositas und mangelnde Bewegung, familiäre Belastung nehmen zu. Ausserdem hat sich mit den Ergebnissen der Langzeituntersuchung aus der HAPO Studie bestätigt, dass ein nicht erkannter und nicht behandelter GDM bei den Kindern im jugendlichen Alter zu einem höheren Risiko für einen gestörten Glucosestoffwechsel führt. Die Theorie der intrauterinen Prägung hat sich mit diesen Daten bestätigt. Wir müssen neben der Reduktion der maternalen Komplikationen wie Präeklampsie und SIH auch für die zukünftige Gesundheit der Kinder sorgen.
Ehm: Was sind die Hauptgefahren des GDM für die Mutter und für das Kind?
Hösli: Bei der Mutter sind dies u.a. das Risiko für SIH, Präeklampsie, höhergradige Geburtsverletzungen bei einem makrosomen Kind. Beim Kind besteht bei Makrosomie das Risiko für eine Schulterdystokie und postpartal das Risiko einer Hypoglykämie.
Ehm: Der OGTT ist ja bei den Frauen nicht sehr beliebt (Nausea, Erbrechen, Ekel). Könnte man nicht auch mehrere HbA1c-Bestimmungen machen?
Hösli: Das Screening mittels HbA1c ist sinnvoll zum Ausschluss eines vorbestehenden DM in der Frühschwangerschaft. Allerdings muss die Diagnose DM dann durch einen 2. Test (z. B. Nüchtern-Glucose) bestätigt werden. Für die Diagnose eines GDM hat das HbA1c eine deutlich geringere Sensitivität für das Vorliegen eines GDM. Wahrscheinlich müsste man tiefere Normwerte wählen, aber dazu gibt es keine Daten in der Schwangerschaft. Man darf auch nicht vergessen, dass z. B. bei einer Fe-Anämie oder Hämoglobinopathie die HbA1c-Werte verändert sind.
Ehm: Welches ist vom Medizinischen her gesehen das optimale Screeningverfahren?
Hösli: Das ist eine sehr gute Frage, die wir viel diskutiert haben. Gemäss neuerer Publikationen gibt es keinen Unterschied im primären Outcome «large for gestational age», wenn man das einzeitige mit dem zweizeitigen Screening vergleicht, bei deutlich geringerer Prävalenz an GDM. Wir wissen aber nicht, ob das Langzeitoutcome für die Kinder gleich ist, da hierzu keine Daten existieren. Somit lässt sich die Frage, welches Screening verfahren zu bevorzugen ist, zur zeit nicht abschliessend beurteilen und sollte individuelle maternale und geburtshilfliche Risiken miteinbeziehen. Der Weg zu einem kosten- und gleichzeitig schwangeren- und anwenderfreundlichen Screening liegt wahrscheinlich auch eher bei einem Risiko-adaptieren Screening, bei dem beide Verfahren, das ein- und das zweizeitige Vorgehen, zum Einsatz kommen.
Ehm: Welches ist von der Praktikabilität her das noch gerade akzeptable pragmatische Screeningverfahren? Wir haben in der Schweiz seit 2011 die Möglichkeit über den Nüchtern-BZ
Hösli: Ja, genau. Wir praktizieren in der Schweiz eigentlich bereits seit 2011 ein individuelles Vorgehen unter Einbezug des Nüchtern-BZ. Damit haben wir nur eine gering tiefere Sensitivität, können aber bei ca. der Hälfte der Schwangeren auf einen 75 g oGTT verzichten. Dieses Verfahren sollte allerdings nicht bei Frauen mit Risikofaktoren wie hoher BMI, vorausgegangener GDM etc. angewendet werden.
Bern
David.Ehm@hin.ch