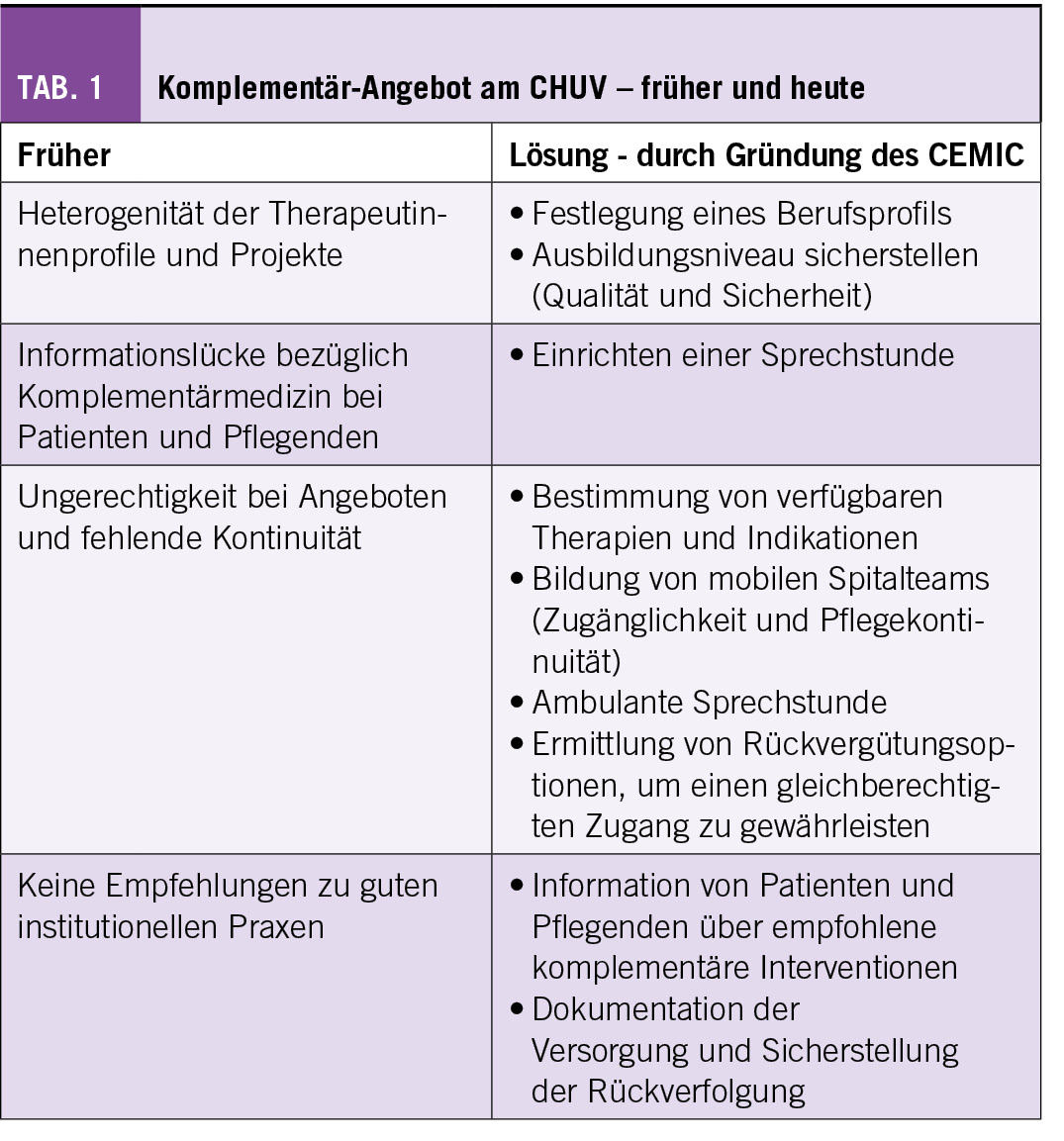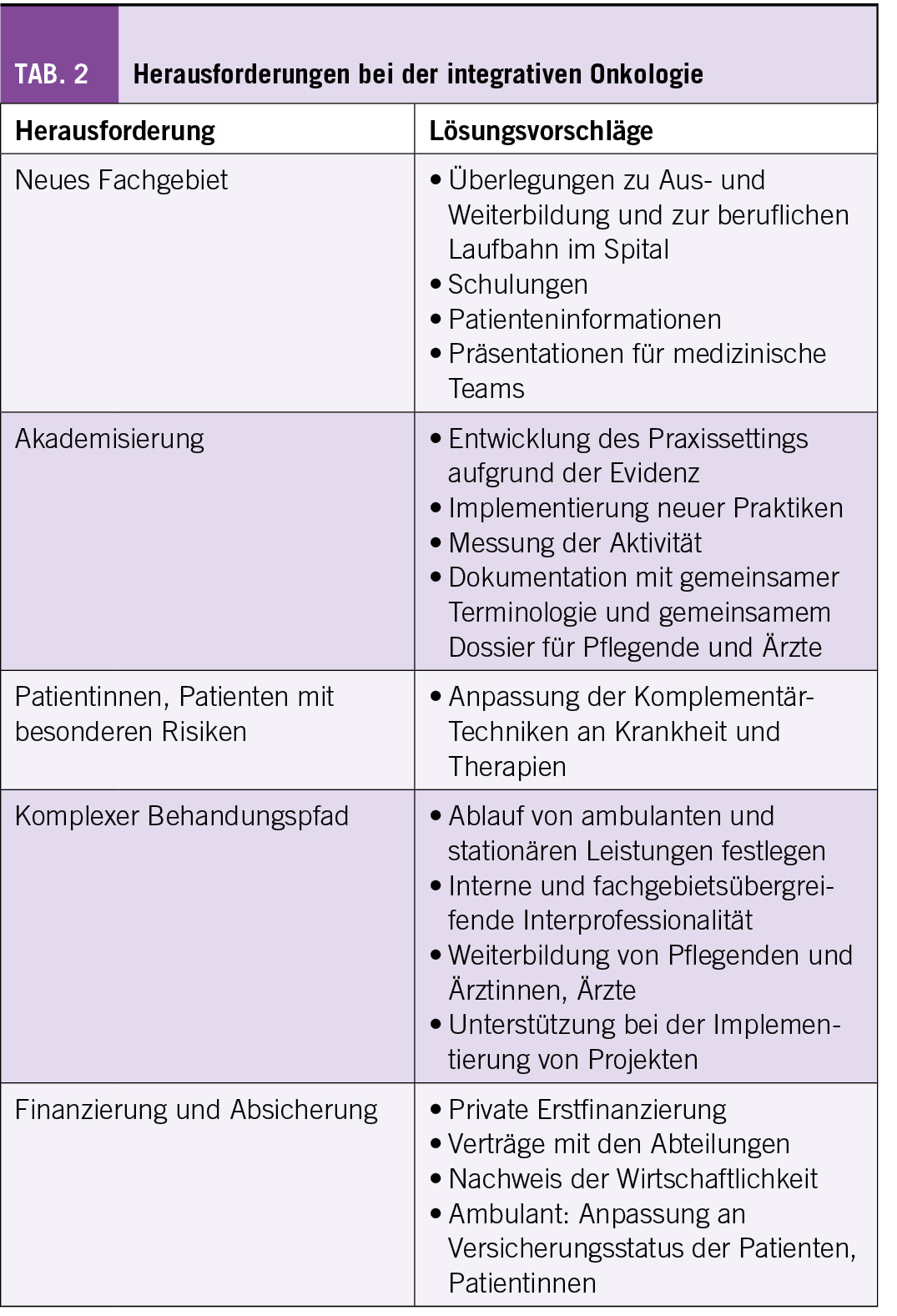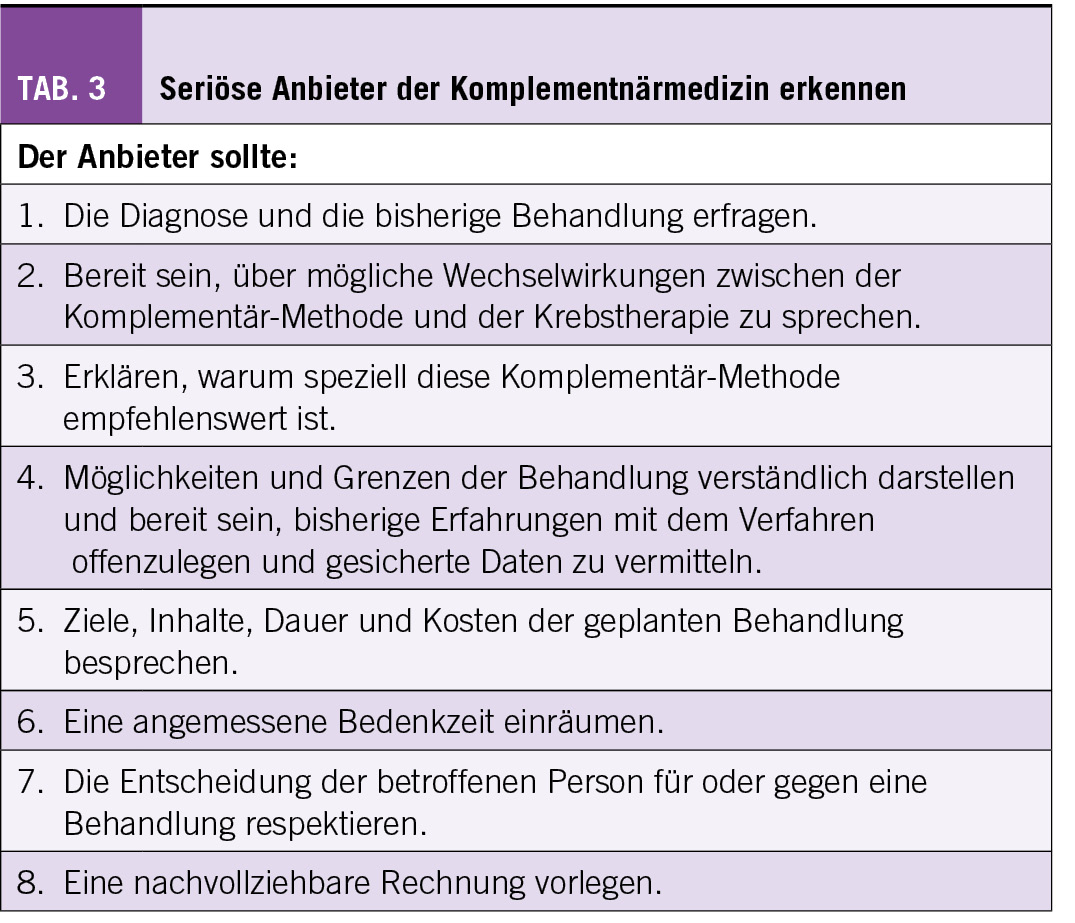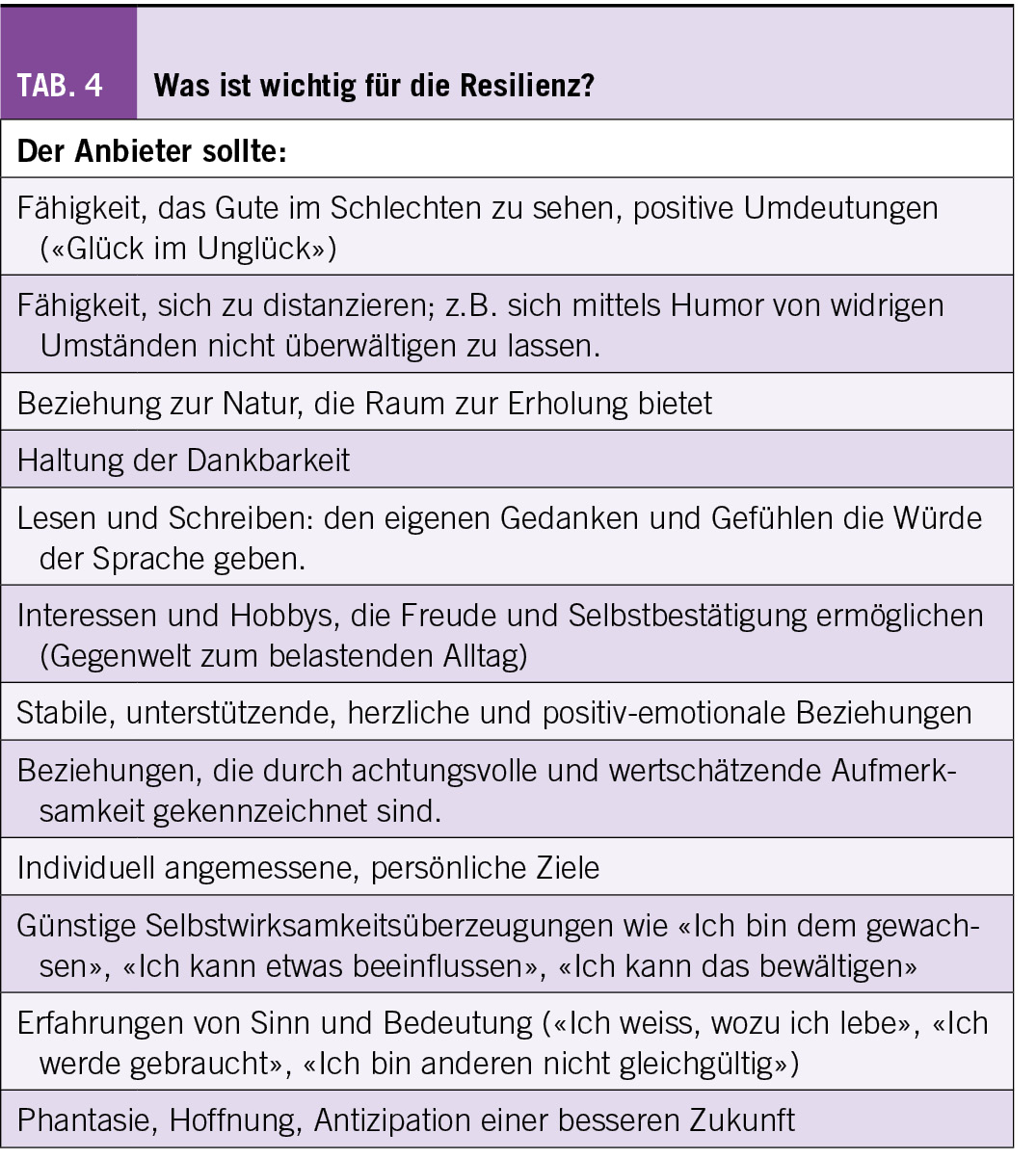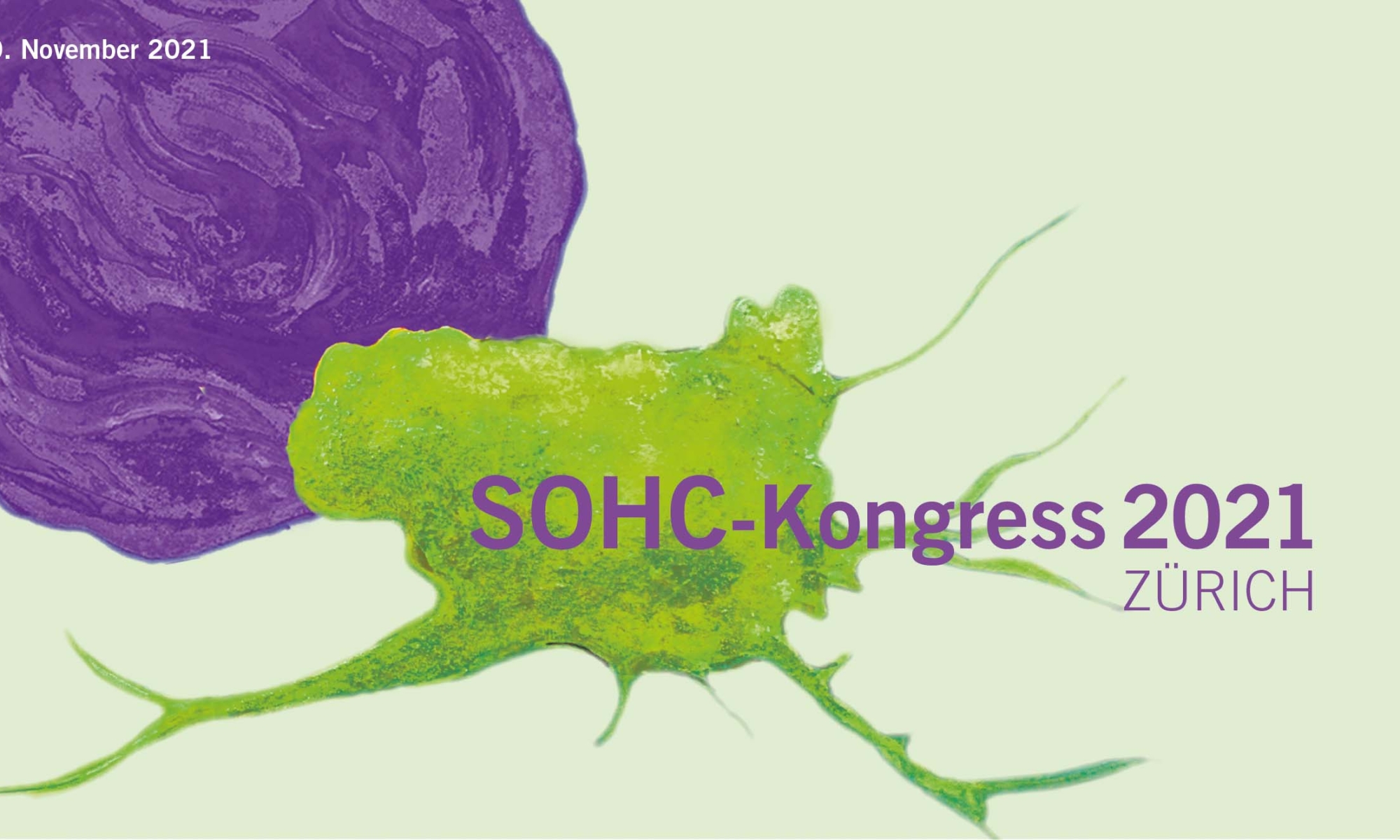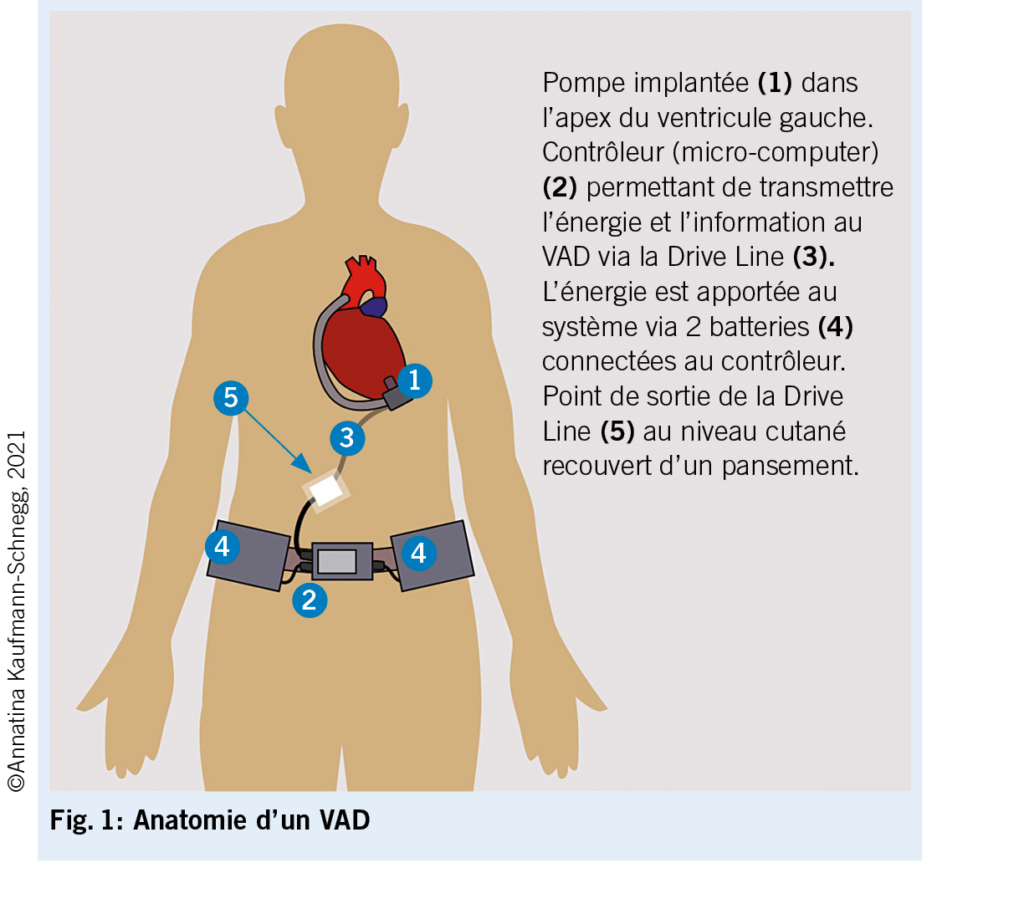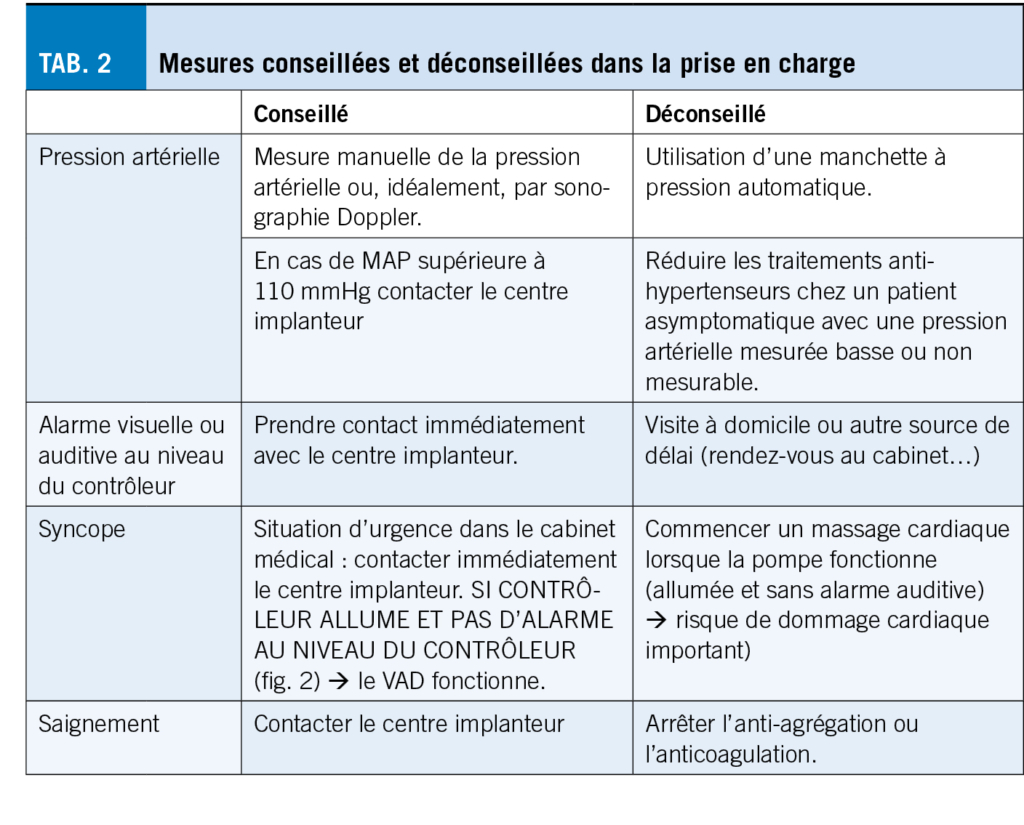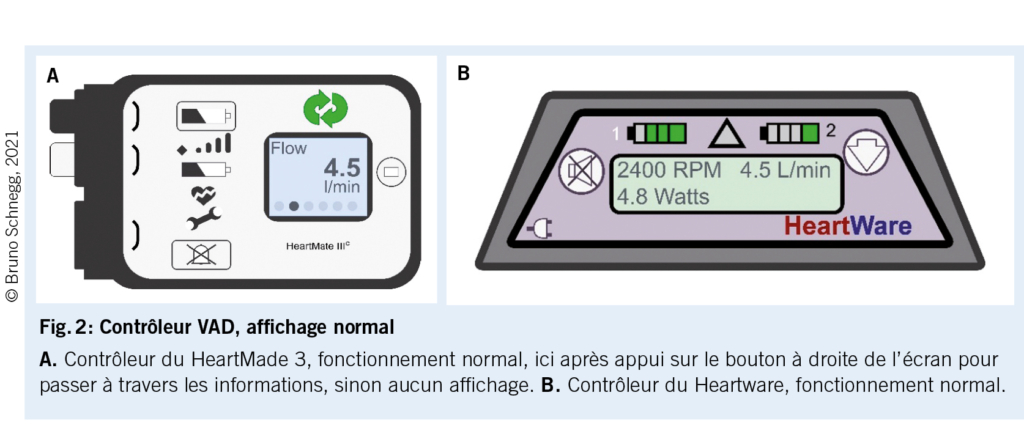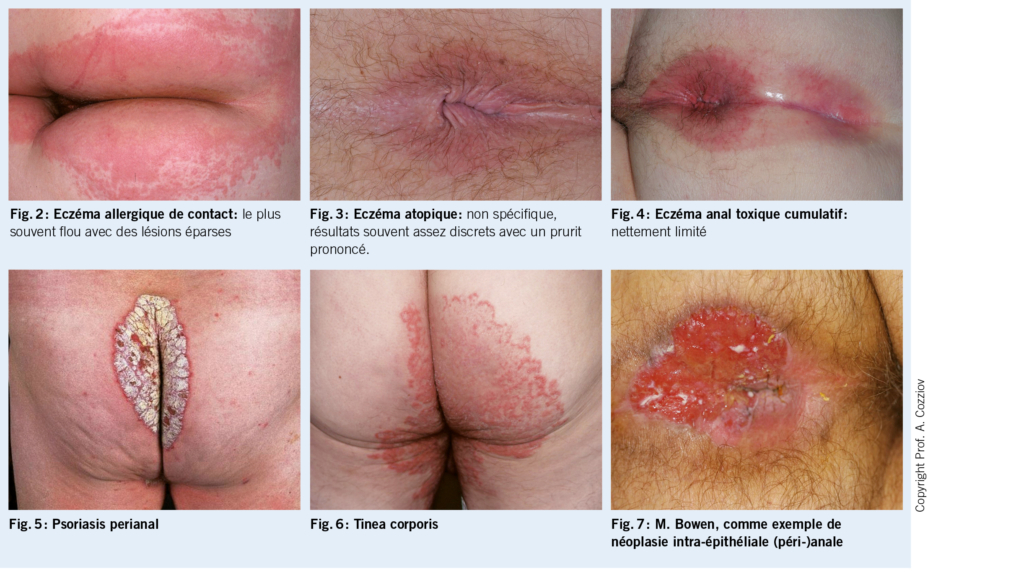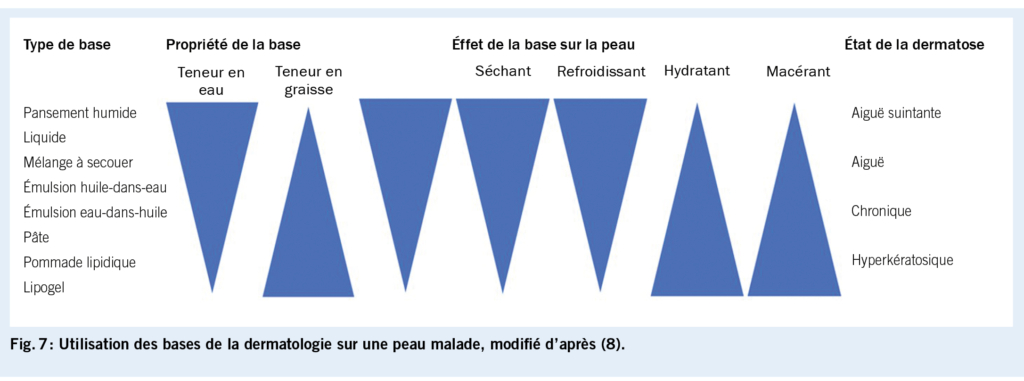Gesundheitspolitischer Schwerpunkt in der Wintersession 2021 der eidgenössischen Räte waren einmal mehr die Änderung des Covid-19-Gesetzes sowie die Diskussionen um die kostendämpfenden Massnahmen im Gesundheitswesens. Im Folgenden werden krebspolitisch relevante Entscheide aus Wintersession 2021 vorgestellt:
Voranschlag 2022 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2023-2025 (21.041)
Geschäftstyp: Geschäft des Bundesrates
Stand der Beratung: angenommen (Antrag Erhöhung Kohäsionsbeitrag abgelehnt)
Nächster Schritt: erledigt
Das Scheitern des Rahmenabkommens mit der EU hat für den Forschungsplatz Schweiz gravierende Folgen. Deshalb hat die Aussenpolitische Kommission (APK-N) ihrem Rat beantragt, den Schweizer Kohäsionsbeitrag um eine weitere Milliarde zu erhöhen. Die Erhöhung wollte die Kommission an die Bedingung knüpfen, dass die Assoziierungsvereinbarungen zwischen der Schweiz und der EU zur Teilnahme an den laufenden EU-Programmen Horizon Europe, Digital Europe, ITER, Euratom und Erasmus+ bis zum 30. Juni 2022 unterzeichnet werden können. Eine Minderheit beantragt im Nationalrat am 1. Dezember 2021 dies zu streichen – und setzte sich mit 93 zu 84 Stimmen durch. Bundesrat Ueli Maurer erklärte, dass es nicht einfach mit einer Zahlung getan sei, die Erwartung in Brüssel seien völlig anderer Natur und einen Zugang zu Horizon würde man mit so einer Zahlung auch nicht bekommen.
Die Oncosuisse begrüsst, dass die zeitnahe Assoziierung der Schweiz an Horizon Europe und damit verbundenen Programmen und Initiativen weiterhin das erklärte Ziel des Bundesrates ist. Die europäische Forschungszusammenarbeit ist zentral, damit die Schweiz ihren Spitzenplatz in der Krebsforschung halten. Ansonsten wird der Forschungs- und Innovationsplatz Schweiz im europäischen Netzwerk benachteiligt. Ausserdem büsst die Schweiz für talentierte Nachwuchs- und Spitzenforscher und -forscherinnen deutlich an Attraktivität ein.
Ergänzung von Artikel 64a des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung betreffend Vollstreckung der Prämienzahlungspflicht der Versicherten (16.312)
Geschäftstyp: Standesinitiative Kanton Thurgau
Stand der Beratung: Differenzbereinigung
Nächster Schritt: Kommission Erstrat (SGK-S)
Die SGK-S hat die Standesinitiative zum Anlass genommen, die Probleme, die sich durch die Folgen der Nichtbezahlung der Prämien und Kostenbeteiligung ergeben, integral anzugehen und das Verfahren umfassend zu verbessern. Folgende Punkte hat der Kommission nach der Vernehmlassung in der Vorlage belassen: Junge Erwachsene sollen nicht für Prämienausstände belangt werden können, die in der Zeit ihrer Minderjährigkeit entstanden sind. Die Zahl der Betreibungen soll begrenzt werden. Aufgrund der Rückmeldungen in der Vernehmlassung senkt die Kommission die Limite jedoch von vier auf zwei Betreibungen pro Jahr. Säumige Versicherte sollen in einem Modell mit eingeschränkter Wahlfreiheit des Leistungserbringers versichert werden. Die Kantone sollen, wenn sie dies wünschen, die Verlustscheine übernehmen und selbst bewirtschaften können. Dafür sollen sie den Versicherern 90 Prozent der ausstehenden Forderungen vergüten. Umstritten war insbesondere, ob Listen mit säumigen Zahler/-innen weiterhin geführt werden können (sogenannte schwarze Listen).
Wer seine Krankenkassenprämien oder Kostenbeteiligungen trotz Betreibung nicht bezahlt, landet heute in den Kantonen Luzern, Thurgau, Aargau, St. Gallen, Tessin und Zug auf einer schwarzen Liste. Die Kantone Graubünden, Solothurn, Schaffhausen und St. Gallen haben diese wieder abgeschafft, da sie nicht die gewünschten Ergebnisse brachten. Thurgau und Zug sprechen hingegen von guten Erfahrungen, weil sie die schwarzen Listen mit Hilfsangeboten und einem Fallmanagement kombinieren. Die Vernehmlassung der SGK-S ergab ein klares Resultat: Nebst den Leistungserbringern und Krankenversicherern sprachen sich 19 Kantone und die GDK für die Abschaffung von schwarzen Listen aus. Trotzdem schlägt die Kommission nach der Auswertung vor, den Kantonen im Rahmen des föderalistischen Vollzugs weiterhin die Möglichkeit der Führung solcher Listen zu geben. Da der Begriff der Notfallbehandlung zu Auslegungsschwierigkeiten geführt hat, soll er jedoch folgendermassen definiert werden:
Eine Notfallbehandlung liegt vor, wenn die Behandlung nicht aufgeschoben werden kann. Dies ist der Fall, wenn die versicherte Person ohne sofortige Behandlung gesundheitliche Schäden oder den Tod befürchten muss oder die Gesundheit anderer Personen gefährden kann.
Der Ständerat stimmte dem Antrag der SGK-S mit 22 zu 22 Stimmen und Stichentscheid des Präsidenten zu, und will damit den Kantonen weiterhin die Möglichkeit geben, schwarze Listen zu führen. Nach dem Ständerat im Sommer, befasste sich der Nationalrat in der Wintersession als Zweitrat mit der Vorlage. Wie im Ständerat war auch die Abstimmung im Nationalrat knapp: Die grosse Kammer stimmte mit 98 zu 92 Stimmen bei 2 Enthaltungen gegen die Abschaffung der Listen säumiger Prämienzahlender. Zudem schuf sie einige Differenzen zum Ständerat: Prämien sollen vom Lohn abgezogen und an den Versicherer überwiesen werden können, es soll keinen erzwungenen Kategorien- oder Versicherungsmodellwechsel geben und Prämien können vom Betreibungsamt gezahlt werden können, wenn der Lohngepfändet ist. Nun befasst sich die SGK-S mit den Differenzen am 20./21. Januar 2022 mit den Differenzen.
Die Oncosuisse begrüsst, dass das Vorgehens bei Nichtbezahlen der Prämien umfassend verbessert werden soll. Denn immer mehr Versicherte können ihre Krankenkassenprämien nicht mehr bezahlen. Und auch in der Schweiz bedeutet eine Krebserkrankung ein zusätzliches Armutsrisiko. Ein Teil der Krebsbetroffenen hat zunehmend Schwierigkeiten, Krankenkassenprämien, Franchisen und Selbstbehalte zu bezahlen.
Landen Krebsbetroffenen auf einer schwarzen Liste, droht ihnen heute ein Leistungsstopp, was lebensbedrohliche Folgen haben kann. Deshalb spricht sich die Oncosuisse wie der Bundesrat und die GDK für die Abschaffung der schwarzen Liste aus. Der Zugang zu Behandlungen von lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Krebs muss jederzeit sichergestellt sein Ebenso dürfen für (Krebs-)Betroffene keine Versicherungslücken entstehen. Festzuhalten bliebt, dass mit deren Abschaffung das eigentliche Problem der Krankenkassen-Prämienlast für Menschen mit knappen finanziellen Mitteln nicht vollständig gelöst sind.
Änderung der gesetzlichen Grundlagen, sodass Swissmedic Dosierungen und Packungen von Arzneimitteln auch dann auf die
Spezialitätenliste setzen kann, wenn das Gesuch nicht vom Hersteller stammt (19.508)
Geschäftstyp: Parlamentarische Initiative
Urheber/-in: Crottaz Brigitte (SP/VD)
Stand der Beratung: Folge gegeben (Phase 1)
Nächster Schritt: Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs, Vernehmlassung
Die gesetzlichen Grundlagen sollen so geändert werden, dass ohne ausdrückliches Gesuch der Pharmaindustrie spezielle, günstigere Dosierungen von bereits in anderen Dosierungen zugelassenen Arzneimitteln in die Spezialitätenliste aufgenommen werden können. Inhaltlich ist der Vorstosstext nicht korrekt, er vermischt die beiden Prozesse der Zulassung bei Swissmedic und die Aufnahme auf der Spezialitätenliste des Bundesamtes für Gesundheit. Der Grundsatz wird aber von beiden Kommissionen unterstützt: Die SGK-N gab dem Anliegen im Januar 2021 Folge. Die SGK-S folgte am 10./11. November 2021. Somit hat nun die SGK-N den Auftrag, einen entsprechenden Entwurf ausarbeiten und diesen in die Vernehmlassung zu schicken.
Im Rahmen der Oncosuisse-Initiative ein erweitertes Antragsrecht für die Zulassung sowie die SL-Aufnahme für patentabgelaufene Arzneimittel als möglicher Lösungsansatz zur Reduktion der Kostengutsprachen im Rahmen der Einzelfallvergütung gemäss Art. 71a-71d KVV identifiziert. Dies betrifft allerdings nicht nur Dosierungsänderungen sondern auch Indikationen: Im Fall von routinemässigen Behandlungen oder basierend auf internationalen Behandlungsrichtlinien oder ausreichend publizierter Evidenz sollen interessierte Organisationen, wie medizinische Fachgesellschaften, Patientenorganisationen oder Krankenversicherer, im Interesse der Patientinnen und Patienten oder der Versicherten, die Zulassung für neue oder erweiterte Indikationen von Wirkstoffen bei Swissmedic und ebenso die Aufnahme auf die Spezialitätenliste beim Bundesamt für Gesundheit beantragen können.
Für eine nachhaltige Finanzierung von Public Health-Projekten des nationalen Konzepts seltene Krankheiten (21.3978)
Geschäftstyp: Kommissionsmotion
Urheber/-in: SGK-S
Stand der Beratung: Behandlung Erstrat (Ständerat)
Nächster Schritt: Behandlung Kommission Zweitrat (SGK-N)
Der Bundesrat soll beauftragt werden, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, um die Umsetzung der Massnahmen des nationalen Konzepts seltene Krankheiten durch die beteiligten Organisationen des Gesundheitswesens nachhaltig zu sichern. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion. Der Ständerat folgte seiner Kommission und dem Bundesrat in der Wintersession 2021 stillschweigend. Nun wird die SGK-N den Vorstoss beraten. Ein Termin ist noch nicht bekannt.
Oncosuisse begrüsst, dass ein solche gesetzliche Grundlage geschaffen wird. Die Massnahmen des nationalen Konzepts seltene Krankheiten betreffen auch die Versorgung und Beratung von Menschen mit seltenen Krebserkrankungen. Zudem wird die Umsetzung der Motion interessant sein im Hinblick auf die mögliche Finanzierunggrundlage der Massnahmen des Oncosuisseforums.Der Bundesrat soll beauftragt werden, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, um die Umsetzung der Massnahmen des nationalen Konzepts seltene Krankheiten durch die beteiligten Organisationen des Gesundheitswesens nachhaltig zu sichern. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion. Der Ständerat folgte seiner Kommission und dem Bundesrat in der Wintersession 2021 stillschweigend. Nun wird die SGK-N den Vorstoss beraten. Ein Termin ist noch nicht bekannt.
Oncosuisse begrüsst, dass ein solche gesetzliche Grundlage geschaffen wird. Die Massnahmen des nationalen Konzepts seltene Krankheiten betreffen auch die Versorgung und Beratung von Menschen mit seltenen Krebserkrankungen. Zudem wird die Umsetzung der Motion interessant sein im Hinblick auf die mögliche Finanzierunggrundlage der Massnahmen des Oncosuisseforums.
Leiterin Politik und Public Affairs Krebsliga Schweiz