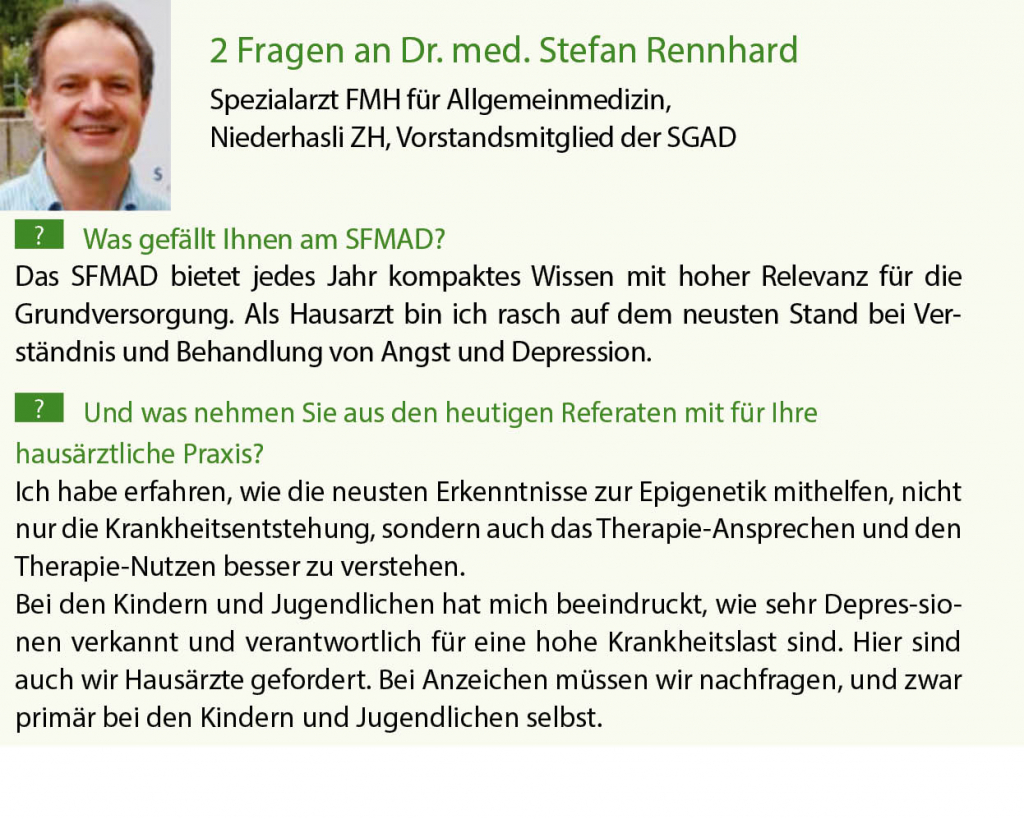- 10 Jahre SGAD – State of the Art
Anlässlich des diesjährigen Swiss Forum for Mood and Anxiety Disorders (SFMAD), dem 10-jährigen Jubiläum, setzte die Schweizerische Gesellschaft für Angst und Depression (SGAD) den State of the Art bei den Behandlungsstandards sowie bei den aktuellen Entwicklungen und Fortschritten im Verständnis der häufigsten psychischen Störungen Angst und Depression ins Zentrum.
Seit genau 10 Jahren erbringt die Schweizerische Gesellschaft für Angst und Depression (SGAD) wichtige Aufklärungs- und Fortbildungsarbeit zu den häufigsten psychischen Störungen. Auch am Jubiläumssymposium erhielten Psychiater und Hausärzte einen auf sie zugeschnittenen Überblick zu den neusten Entwicklungen.
State of the Art bei Angststörungen – Schwerpunkt Epigenetik
Prof. Dr. Dr. med. Katharina Domschke M.A. (USA), Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Freiburg, präsentierte spannende Einblicke in die Interaktion zwischen Genetik und Umwelteinflüssen bei der Entstehung von Angsterkrankungen. Genetische Faktoren spielen eine grosse Rolle. Hunderte von Genen sind dafür bekannt, dass sie in einem komplexen Zusammenspiel das Risiko für eine Angsterkrankung erhöhen. Ist eine gewisse genetisch bedingte Vulnerabilität vorhanden, können soziale Ereignisse und Umweltfaktoren dazu beitragen, die Schwelle zur Erkrankung zu überschreiten. Doch wer übernimmt die Aufgabe des Dolmetschers zwischen genetischer Prädisposition und psychosozialen Risikofaktoren? Sogenannte epigenetische Modifizierungen. Dies sind biochemische Veränderungen der DNA und deren Raumstruktur, welche die Genaktivität und damit die Proteinproduktion steuern. Eine Art der epigenetischen Modifizierung ist die Methylierung von regulatorischen DNA-Sequenzen (Promotoren). Ist ein Promotor methyliert, wird das entsprechende Gen weniger aktiv abgelesen. Wird die Methylierung entfernt, steigt die Genaktivität. Dieser Zusammenhang konnte für das Monoaminooxidase-A-Gen (MAOA), ein bekanntes Risikogen für Angsterkrankungen, bestätigt werden. Der MAOA-Methylierungsstatus im Blut korreliert negativ mit der MAOA-Aktivität im Gehirn. Und diese hat wiederum Auswirkungen auf neurobiologische Prozesse, die entscheidend für den psychischen Gesundheitsstatus sind. So wurde bei Patienten mit Panikerkrankungen oder Depressionen im Vergleich zu Gesunden ein niedriger MAOA-Methylierungsstatus festgestellt, welcher somit als Marker oder Risikofaktor für diese Erkrankungen gelten könnte. Zudem kann der MAOA-Methylierungsstatus als Prädiktionsfaktor für das Ansprechen auf eine SSRI-Therapie bei Depression dienen: Patienten mit niedrigem MAOA-Methylierungsstatus erzielten nämlich schlechtere Therapieerfolge als Patienten mit hohem Methylierungsstatus.
Eindrücklich zeigte Prof. Domschke auf, dass epigenetische Modifizierungen durch Lebensereignisse dynamisch verändert werden können: So korreliert die Erfahrung von subjektiv negativen Lebensereignissen mit einem verminderten MAOA-Methylierungsstatus. Positive Lebensereignisse hingegen korrelieren mit einem erhöhten MAOA-Methylierungsstatus. Auch Psychotherapie kann Methylierung wiederherstellen: Es wurde gezeigt, dass Menschen mit einer Panikstörung, die auf eine kognitive Verhaltenstherapie ansprachen, nach der Therapie eine signifikante Erhöhung der MAOA-Methylierung aufwiesen. Bei denjenigen Patienten, die nicht auf die Therapie ansprachen, blieb sie hingegen gleich oder nahm sogar ab.
Prädiktion und Entwicklung von Depressionen im Jugend- und Erwachsenenalter
Prof. Dr. med. Martin Preisig, Psychiatrische Universitätsklinik Lausanne, befasst sich zusammen mit seiner Forschungsgruppe seit über 20 Jahren mit der Frage, welche prädiktiven Faktoren die Entstehung von unipolaren oder bipolaren Affektstörungen begünstigen. Die Identifikation und Kenntnis von modifizierbaren Risikofaktoren ist wertvoll, da dies eine Möglichkeit für präventive Massnahmen darstellt. So ist das Risiko für Kinder, bei denen ein Elternteil eine bipolare Störung (Manie/Hypomanie) hat, um den Faktor 9 erhöht, ebenfalls an dieser Störung zu erkranken. Für Kinder mit einem depressiven Elternteil ist das Risiko immer noch mehr als doppelt so hoch. Generell haben bipolare Störungen oder Depressionen ihren Ursprung bereits im frühen Kindesalter. Die Prädiktoren für bipolare Störungen und Depression sind dabei unterschiedlich. So ist bei Manien/Hypomanien eine bipolare Störung der Eltern und/oder eine schon vorhandene Depression ein ausgeprägter prädiktiver Faktor. Bei Depressionen hingegen spielen Psychotraumata, wie etwa sexueller Missbrauch oder Gewalt in der Familie, eine grössere prädiktive Rolle.
Im Gegensatz dazu ist die Prädikation einer Depression bei Erwachsenen vom Subtyp der Depression abhängig. So sind bei einer unspezifischen Depression Life Events prädiktiv, wohingegen bei der melancholischen Depression Neurotizismus und vorgängige unterschwellige depressive Syndrome eine Rolle spielen. Bei der atypischen Depression ist zusätzlich zu Neurotizismus und vorgängigen unterschwelligen depressiven Syndromen auch ein erhöhter BMI prädiktiv. Zusammenfassend sind die prädiktiven Faktoren von Depressionen im Jugend- und Erwachsenenalter sehr unterschiedlich und bieten so eine Möglichkeit die Krankheit gezielt abzuwenden.
Omega-3-Fettsäuren gegen mittelgradige und schwere Depressionen im Kindes- und Jugendalter
PD Dr. med. Gregor Berger, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Psychiatrische Universitätsklinik, Zürich, betonte, dass Depressionen bei Kindern und Jugendlichen häufig nicht oder falsch diagnostiziert werden. So erfüllt beispielsweise ein Grossteil der Kinder und Jugendlichen mit der Diagnose «Anpassungsstörung» auch die Kriterien einer – zumindest leichten – Depression. Zur Problematik bei der Diagnosestellung kommt erschwerend eine bei Kindern und Jugendlichen sehr eingeschränkte Zahl an pharmakologischen Therapieoptionen hinzu. So ist in der Schweiz kein Antidepressivum zur Behandlung der klinischen Depression zugelassen. Dabei wäre gerade bei dieser Patientengruppe eine optimale, langfristige Behandlung der Schlüssel zum Erfolg. Nach der ersten depressiven Episode erleidet die Hälfte der Betroffenen eine zweite Episode. Nach der zweiten Episode erhöhte sich das Risiko für eine zusätzliche Episode bereits auf 80% und man kann von einer Chronifizierung ausgehen. Spätestens nach der dritten depressiven Episode ist eine lebenslange Rückfallprophylaxe empfohlen.
PD Dr. Berger forscht intensiv zur antidepressiven Wirkung von Omega-3-Fettsäuren bei Kindern und Jugendlichen und leitet die derzeit laufende multizentrische Schweizer Studie Omega-3-pMDD – mit einer angestrebten Zahl von 220 eingeschlossenen depressiven Kindern und Jugendlichen die grösste Studie dieser Art weltweit. Die Omega-3-pMDD-Studie ist randomisiert und placebokontrolliert. In der Behandlungsgruppe werden zusätzlich zur Basistherapie die beiden Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaensäure (eicosapentaenoic acid, EPA, 1000 mg täglich) und Docosahexaensäure (docosahexaenoic acid, DHA, 500 mg täglich) verabreicht. Die bisherige Evidenz zur antidepressiven Wirkung von mehrfach ungesättigten Fettsäuren legt nämlich nahe, dass EPA einen Anteil von mindestens 60% der Gesamtmenge ungesättigter Fettsäuren ausmachen sollte und dass eine Kombination von EPA und DHA effektiver ist als EPA bzw. DHA allein. Die Omega-3-pMDD-
Studie wird untersuchen, ob besonders Kinder und Jugendliche, die einen vorbestehenden Mangel an Omega-3-Fettsäuren oder einen erhöhten inflammatorischen Grundstatus haben, von dieser neuen Therapieoption profitieren.
Quelle: 10th Swiss Forum for Mood and Anxiety Disorders (SFMAD), 4. April 2018, Zürich
der informierte @rzt
- Vol. 9
- Ausgabe 4
- April 2019