- 4 Disziplinen – 1 Ziel
Diese Frage und weitere Fragen waren Gegenstand einer Fortbildung des Stadtspitals Zürich und der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich, die am 2. Februar im Hotel Marriott, Zürich, unter der Leitung von Prof. Dr. med. Christoph Gubler, Chefarzt Gastroenterologie, Stadtspital Zürich und Dr. med. Josef Widler, ehemaliger Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich, stattfand. Der durch die Medworld AG, Steinhausen, professionell und exzellent durchgeführte Anlass wurde durch die Firmen Amgen und Galderma unterstützt. Die 4 Disziplinen waren Hausarztmedizin, Dermatologie, Rheumatologie und Gastroenterologie. Die Fortbildung fand interaktiv mit einer online Befragung und Auswertung statt.
1. Von den Schnittstellen der Hausarztmedizin zur Nahtstelle der Spezialisten – Wie betreuen wir Patienten professionell?
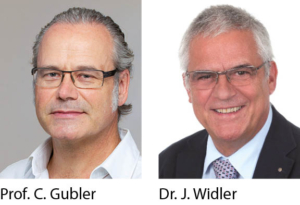
«Das Ziel meines Vortrags ist, die Bedürfnisse der Hausärzte zu erfassen und was die Hausärzte von den Spezialisten erwarten», erklärte Dr. Widler zu Beginn seiner Ausführungen. Nach Wikipedia ist der Hausarzt ein Arzt, eine Ärztin, der/die sich mit der Vorbeugung (Prävention), Erkennung (Diagnose), Behandlung (Therapie) und Nachsorge von Krankheiten und Verletzungen (Patientenversorgung) beschäftigt, insgesamt eine umfassende Tätigkeit. Die FMH beschreibt die Hausarztmedizin etwas dürftig wie folgt: Hausarztmedizin stellt normalerweise den ersten medizinischen Kontakt im Gesundheitssystem dar und gewährleistet einen offenen und unbegrenzten Zugang für alle Nutzer und für alle Gesundheitsprobleme, unabhängig von Alter und Geschlecht. Solches bieten auch die Apotheker an, wie der Referent feststellte. Dr. Widler sieht die Tätigkeit des Hausarztes in der umfassenden Beurteilung der Patientinnen und Patienten, in einer abschliessenden Diagnose und Therapie. Der Hausarzt sollte 80% der Patienten abklären und behandeln und mit gutem Gewissen nach Hause schicken können. Daneben gibt es jene Patienten, die einen Spezialisten benötigen. Dabei spielt die Wahl der Spezialistin eine grosse Rolle: Wenn sie gut ist, ist der Hausarzt auch gut, im andern Fall ist auch der Hausarzt betroffen. Dann gibt es noch den Notfall, der eine Spitalüberweisung benötigt.
Verdacht Autoimmunerkrankung
Das Thema der Fortbildung war den Autoimmunerkrankungen gewidmet. Wenn der Hausarzt einen Patienten mit einer Autoimmunerkrankung überweisen will, sollte er wissen, worauf zu schauen ist. Die Fragen an die Teilnehmer betrafen denn auch das Gebiet der Autoimmunerkrankungen.
Wie viele Ihrer Patientinnen stehen zurzeit unter einer immunsuppressiven Therapie?
1. weiss nicht, 2. keine, 3. 1-5, 4. 6-10, 5. mehr als 10
Von 24 Teilnehmern antwortete die Mehrheit (10) mit Antwort 5 (mehr als 10).
Was ist der häufigste Grund einer Immunsuppression Ihrer Patienten?
1. eine rheumatologische Krankheit? 2. eine gastroenterologische Krankheit? 3. eine dermatologische Krankheit? 4. eine neurologische Krankheit? 5. ein Karzinom? 6. eine stattgehabte Transplantation?
Die überwiegende Mehrheit votierte für eine rheumatologische Krankheit.
Tätigkeit bei immunsupprimierten Patienten.
1. BSR bestimmen, 2. CRP bestimmen, 3. Impfstatus überprüfen,
4. Keine Lebendimpfstoffe verimpfen, 5. Nierenfunktion prüfen
Alle diese Tätigkeiten wurden als wesentlich angesehen.
Wie schätzen Sie Ihr Wissen über den Einsatz von immunsupprimierenden Medikamenten ein?
– Ich kenne die meisten Indikationen
– Ich kenne die häufigsten Nebenwirkungen
– Ich kenne die Medikamente, die interagieren
– Ich kenne die Krankheiten, die eine Gefahr für Immunsupprimierte darstellen
1. Keine der Aussagen trifft zu, 2. Eine Aussage trifft zu, 3. Zwei Aussagen treffen zu, 4. Drei Aussagen treffen zu, 5. Alle Aussagen treffen zu
Das Wissen war über alle Antworten gestreut.
Verdacht einer Autoimmunerkrankung, die zur Überweisung an einen Spezialisten führen sollte:
Akne inversa/Hidradenitis suppurativa
Welche der folgenden Aussagen ist bezüglich Aetiologie und Pathophysiologie der Akne inversa richtig?
1. Primär beginnt die Erkrankung mit einem Follikelverschluss und
mit einer Entzündung des Haarfollikels, 2. Bis 40% der Patienten haben eine positive Familienanamnese für Akne inversa, was auf eine mögliche genetische Veranlagung hinweist, 3. Der Beginn ist meist eine bakterielle Infektion der apokrinen Drüsen, 4. Primär besteht eine Entzündung der Talgdrüsen, 5. Nikotinabusus zeigt keine Auswirkung auf die Akne inversa
Die Teilnehmer sprachen sich für 1, 2 und 4 aus.
Was sind die typischen und häufigsten Lokalisationen für Akne inversa/Hidradenitis suppurativa?
1. Kopf, Hals und Rücken, 2. Achselhöhlen, Leistengegend, Anogenitalbereich, 3. Stirn, Kinn, Nase, 4. Wangen, Brust, Oberschenkel
Die grosse Mehrheit votierte für Achselhöhlen, Leistengegend und Anogenitalbereich
Zusammenarbeit Spezialist/Hausarzt
Die Befragung der Teilnehmer umfasste die folgenden Punkte:
1. Die Spezialistin soll die Therapie vollständig übernehmen und mich nach jeder Konsultation orientieren, 2. Die Spezialistin soll die Therapie durchführen. Ich möchte den Patienten aber in gemeinsam definierten Intervallen in meiner Sprechstunde sehen, 3. Ich möchte die klinischen Kontrollen übernehmen, 4 ,Die Spezialistin soll die Therapie vorgeben, aber ich möchte die Laborkontrollen durchführen, 5. Die Spezialistin soll die Therapie vorgeben, aber ich möchte bei der Durchführung (z.B. Infusionen) mitwirken
Die Quintessenz war, dass der Spezialist wissen sollte, was der Hausarzt gerne möchte.
Zusammenarbeit
Hausarzt
Verdachtsdiagnose
Unklarer Befund
Behandlung und Komorbiditäten
Impfstatus
Klinische Kontrolle
Labor
Röntgen
EKG
→
Spezialist
Abklärungen
Diagnose, – Therapie
Spezialuntersuchungen
Diagnose
Beurteilung
Therapie
Planung
Risiken, – Interaktionen
Therapie-Überwachung
Zuzug weiterer Spezialisten
Falls der Spezialist einen weiteren Spezialisten in einem anderen Fach zuzieht, möchte der Referent dies wissen. Der Austausch sollte gegenseitig sein.
Morbus Crohn
Aktiv? Oder andere Ursache eines Durchfalls?
Welcher Test korreliert am besten mit einer signifikanten Crohn-Aktivität (verglichen mit dem Goldstandard Endoskopie)?
1. CRP >5mg/L, 2. Leukozyten >8G/L, 3. Klinik in Form einer standardisierten Beurteilung, 4. Calprotectin >100µg/g
Die überwiegende Mehrheit sprach sich für Calprotectin >100µg/g aus.
Der Bericht
Der Referent zeigte exemplarisch einen Bericht einer Patientin, wie er nicht verfasst werden sollte: 14 Diagnosen, 24 Medikationen und weitere Bemerkungen, die nicht unbedingt zielführend waren. Die Gefahr, dass das Wesentliche überlesen wird, ist dabei sehr gross.
Der Bericht sollte idealerweise den Verlauf, neue Erkenntnisse, Konsequenzen, Therapieanpassungen, wann, welche Kontrolle und durch wen, sowie die Caveats umfassen.
Wie soll die Berichterstattung erfolgen?
1. Telefon, 2. Mail, 3. Post
Eine beliebte Variante ist die Anfrage für ein Telefonat per Mail. Ein grosser Teil wünscht die Zustellung per Mail. Die postalische Zustellung oder das «zeitlich unpassende» Telefon sind eher unpopulär.
Mit welcher Frequenz soll der Bericht erfolgen?
1. Bei Therapiebeginn oder Therapieänderung, 2. Nach jeder Kontrolle, 3. Nach Gutdünken der Spezialistin
Mehrheitlich wurde für Antwort 1 votiert.
2. Expertise Dermatologie – Rezidivierende Abszesse

Zehn Jahre bis zur Diagnose. Es wurden mehr als 3000 Hauterkrankungen beschrieben, stellte Dr. med. Robert Artur Dahmen, Oberarzt Dermatologie, Stadtspital Zürich, fest. Auch die Dermatologen kennen nicht alle. Grundsätzlich gilt: Alles was rot ist kann man mit Elocom® Salbe/Pommade, Fucidin und Imazol® Crèmepaste behandeln. Wenn etwas nicht verheilt, sollte es von einem Dermatologen angeschaut werden. Wie steht es aber mit Abszessen? UBI PUS, IBI EVACUA. Wo Eiter ist, dort räume aus. Sollen wir alle Abszesse den Chirurgen überweisen? Was machen, wenn die Abszesse rezidivierend sind? Immer an die Chirurgen überweisen? Es gibt eine Erkrankung, die durch stets wiederkehrende Rezidive gekennzeichnet ist, die Acne inversa. Sie wurde vom Referenten für diese Fortbildung ausgewählt.
Acne inversa, Hidradenitis suppurativa
Acne inversa ist eine chronisch rezidivierende Hauterkrankung, die entzündlich und nicht infektiös ist. Sie tritt üblicherweise nach der Pubertät auf und kann vernarbend verlaufen. Sie manifestiert sich mit schmerzhaften, tief lokalisierten, entzündlichen Hautläsionen, die in Terminalfollikel- und apokrinen Drüsen-reichen Hautregionen auftreten, am häufigsten in den Axillen, sowie der Inguinal- und Anogenitalregion (Dessauer Definition), überall, wo es Reibung gibt. Die Prävalenz beträgt 0.7-1.2%. Ungefähr 1% (ca. 80’000 der Schweizer Bevölkerung) leidet an Acne inversa. Acne inversa wird oft mit anderen Abszessen verwechselt, was dazu führt, dass die Dauer bis zur Diagnosefindung oft 7-10 Jahre dauert. Die ersten Symptome kommen meistens im Alter von durchschnittlich 23 Jahren, Frauen sind häufiger betroffen als Männer, 50% sind adipös und 90% oder noch mehr sind Raucher. Acne inversa unterscheidet sich von Acne vulgaris dadurch, dass bei Acne inversa die Entzündung deutlich tiefer ist. Genetik, mechanische Belastung, Hormone und Rauchen spielen in der Pathogenese eine wichtige Rolle. Interleukine spielen eine Schlüsselrolle insbesondere in der Therapie.
Am Anfang kommen die Patientinnen mit schmerzhaften kleinen Papeln und Knoten, und es gibt 3 Möglichkeiten für den Verlauf: Die Knoten bilden sich zurück, sie persistieren oder sie wandeln sich in einen Abszess um. Das nennt man Hurley I. Weiter können die Abszesse verschmelzen. Dann entstehen Narben und Fistelgänge. Dieses Stadium nennt man Hurley II. Das schlimmste Stadium wird Hurley III genannt. Typisch ist ein flächiger Befall mit Abszessen und Fistelgängen.
Die Diagnose ist rein klinisch. Cave: Häufig tritt ein Plattenepithelkarzinom auf. Komorbiditäten sind metabolisches Syndrom, polycystisches Ovarialsyndrom, Diabetes Typ 2, psychische Störungen, M. Crohn usw. Die Patientinnen mit Acne inversa haben von allen dermatologischen Erkrankungen die schlechteste Lebensqualität.
Seit 2015 gibt es eine wirksame Therapie mit Adalimumab und kurz danach folgten die ersten Leitlinien (2017). Bei Patientinnen, die nur kleine Knoten und Papeln haben, reicht eine Antibiotika-Therapie mit topischem Clindamycin. Bei schwereren Verläufen braucht es eine systemische Therapie, z.B. mit Doxycyclin oder Rifampicin (beide haben anti-entzündliche Aktivität). Allerdings wurde das Auftreten von Clostridium difficile bei Patientinnen unter Clindamycin und Rifampicin beobachtet.
Adalimumab (Humira®) funktioniert «magic», so der Referent. Auch Secukinumab (Cosentyx®) zeigte klinisch bedeutende Symptomverbesserungen bei Patienten mit Hidradenitis suppurativa in Phase III Studien und wird bald entsprechend eingesetzt werden. Was bleibt sind die Narben, die chirurgisch behandelt werden müssen.
Die Häufigkeit von Rezidiven nach einer Operation beträgt nach radikaler Exzision 13%, nach einfacher Drainage 78-100%, nach einfacher Exzision 22-43% und nach Deroofing 17%.
Take Home Message
Patienten, die chronische Abszesse haben, bitte zum Dermatologen schicken.
3. Expertise Rheumatologie – Ganzheitliche Betreuung von Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen unter Basistherapien: eine Teamleistung.
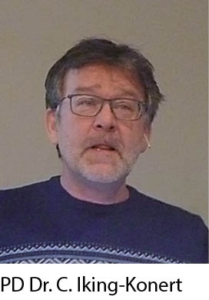
PD Dr. med. Christof Iking-Konert, Chefarzt Rheumatologie, Stadtspital Zürich, stellte zunächst eine 24jährige Medizinstudentin mit Schmerzen der Achillessehne, der LWS und des 4. Fingers links mit Schwellung vor. Familie nicht bekannt. Keine Vorerkrankungen bekannt. Keine Infekte bemerkt.
Labor: hat sie schon mal abnehmen lassen…. Die Laborbefunde (CRP, BSG, RF und ACPA) waren normal.
Die Hände sind die Visitenkarte des Rheumatikers, so der Referent. Die Patientin hatte eine Daktylitis, ein typisches Symptom einer Psoriasis-Arthritis.
Mythos 1: Ohne Rheuma im Blut, kein Rheuma…
Eine entzündliche Erkrankung soll als Diagnose nicht verworfen werden, nur weil die Laborwerte (Entzündungsmarker, Serologie) normal sind. Andererseits bedeuten positive ANA bei einer 80jährigen nicht unbedingt eine rheumatische Erkrankung.
Welches DMARD (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug) wäre nach Ihrer Meinung geeignet?
1. MTX 15mg /Woche, 2. TNF-Blocker (z.B. Adalimumab 40mg s.c./2 Wochen), 3. IL-17 Blocker (z.B. Secukinumab), 4. IL-23 Blocker (z.B. Guselkumab)
Die Schlüsselbereiche der Psoriasisarthritis sind axiale Erkrankung, Nagelerkrankung, Enthesitis, Hauterkrankung, periphere Arthritis, Daktylitis. In allen Fällen sind NSAR die erste Wahl. Bei ungenügender Wirkung stehen heute viele moderne Medikamente zur Verfügung.
Die Patientin will wissen, ob sie denn nun nicht ständig Infekte bekommen würde? Stimmt das?
1. Ja, 2. Nein, 3. Kommt darauf an
Infektionen steigen mit dem Alter, der Anzahl der Risikofaktoren und der Höhe der Glukokortikoidtherapie. Herpes Zoster und DMARD: Bei 12470 RA-Patienten war die Inzidenzrate von Herpes Zoster-Ereignissen pro 1000 Patientenjahre mit den meisten Antirheumatika in der Grössenordnung von 10/1000 Patientenjahre. Eine Ausnahme bildeten die JAK-Inhibitoren, bei denen sie 24.9/1000 Patientenjahre betrug. Die Empfehlungen zur Immunisierung gegen Herpes Zoster hängen von Alter und Therapie ab. Mit oder ohne Immunsuppression sollte jedermann ab 65jährig gegen Herpes Zoster geimpft werden; Immunsupprimierte bereits ab 50jährig.
Mythos 2: Gegen Rheuma kann man doch eh nichts machen.
Die neuen Medikamente heissen Disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARD). Es gibt die konventionellen synthetischen DMARDs, z. B. Methotrexat, die gezielten synthetischen DMARDs, z. B. Tofacitinib (Xeljanz®) und die biologischen DMARDs (monoklonale Antikörper) z. B. Adalimumab (Humira®).
Welches Medikament für welches Stadium sollte der Spezialist entscheiden. Heute ist es eine rein klinische Entscheidung, welches Medikament am besten wirkt.
Mythos 3: Mit Rheuma kann man nicht schwanger werden
Die junge Patientin fragt Sie, wie es denn mit einer Schwangerschaft sei? Sie habe gelesen, dass das mit «Rheuma» unmöglich sei… Stimmt das?
1. Ja, 2. Nein, 3. Kommt darauf an
Schwangerschaft
Immer proaktiv nach Schwangerschaftswunsch fragen. MTX ist streng verboten. Es muss 3 Monate vorher abgesetzt werden. Das Gleiche gilt für Leflunomid (Spiegelmessung). Abatacept, Rituximab und Tocilizumab sollten 1 Monat vor Schwangerschaftsbeginn abgesetzt werden. Es gibt aber auch Medikamente, die in der Schwangerschaft und während der Stillzeit eingesetzt werden können, z.B. Prednisolon, Hydroxychloroquin, Sulfasalazin, Azathioprin.
Krebs
Die junge Patientin berichtet besorgt, dass sie gelesen habe, dass man von den Rheuma-Medikamenten Krebs bekomme und man ausserdem an Rheuma früher sterbe.
Stimmt das? 1. Ja, 2. Nein, 3. Kommt darauf an
Nach 20 Jahren Anwendung haben die Patienten in der Regel kein erhöhtes Krebsrisiko, aber sie sollten sich einer regelmässigen Untersuchung unterziehen. Diese sollte durch den Hausarzt erfolgen. Unter Biologika wurden keine Tumorkomplikationen beobachtet.
Kardiovaskuläres Risiko
Das kardiovaskuläre Risiko ist ein Problem durch die langjährige Entzündung im Rahmen einer rheumatischen Erkrankung.
Mortalität bei RA
RA-Patienten lebten gemäss einer Studie aus dem Jahre 2009 im Schnitt kürzer, dies insbesondere bei unzureichender Therapie der RA. Bei den heutigen Therapiemöglichkeiten und gutem Ansprechen auf die Therapie dürfte die Lebenserwartung kaum vermindert sein.
Fazit: Zusammenarbeit Hausarzt – Spezialist
Die Initialtherapie liegt meistens beim Hausarzt. Die Hausärzte müssen die Erstsymptome erkennen. Der Spezialist ist dabei gerne behilflich.
Die Initialtherapien (NSAR, ggf. Glukokortikoide) werden ebenfalls vom Hausarzt eingesetzt. Die Einleitung der spezifischen Therapie und die Wahl des Medikaments sollte der Spezialist vornehmen. Dies gilt auch für die Überwachung, bis der Patient das Ziel erreicht hat. Danach sollte der Hausarzt das Weiterführen der Therapie übernehmen.
Auch das Absetzen muss überdacht und sollte zusammen mit dem Spezialisten abgeklärt werden.
Die Schwangerschafts-Planung auch gerne über den Spezialisten.
Kardiovaskuläre Vorsorge und Krebsvorsorge durch den Hausarzt.
Das Impfen primär durch den Hausarzt. Der Spezialist weist daraufhin.
4. Expertise Gastroenterologie – Der Crohn Patient in Remission: Beispiel für wertvolle Zusammenarbeit zwischen Grundversorger und Spezialist.

Morbus Crohn wird immer häufiger. Wenn man hochrechnet, sind es mehrere Tausend Patienten im Kanton Zürich, die einen Morbus Crohn haben. Der Crohn-Patient in Remission ist ein Beispiel für eine rezidivierende-remittierende Erkrankung, so PD Dr. med. Bernhard Morell, Leitender Arzt Gastroenterologie, Stadtspital Zürich. Der Verlauf ist nicht absehbar und es besteht die Gefahr der Über- oder Unterbehandlung. Häufig ist zu Beginn die Aktivität höher und nimmt mit der Zeit ab. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall. Der Progress ist oft subklinisch und entwickelt sich mit der Zeit so, dass eine Operation unumgänglich wird. Man kann sich verschiedene Stadien des M. Crohn vorstellen. Es gibt zunächst die Empfindlichkeit für die Entwicklung eines M. Crohn. Sie hängt von der Genetik, der Umgebung, dem Darmmikrobiom und der Immunantwort ab. Hier könnte man erstmals eingreifen, was indessen schwierig ist. Darauf kommt das Fenster der mukosalen Inflammation, die mit Ulzera beginnt. Zuletzt folgt das Stadium der irreversiblen Fibrose mit Fisteln und Abszessen, bei denen die Medikamente nicht mehr helfen.
Diagnostische Mittel sind in der frühen Phase Calprotectin, die Endoskopie (Goldstandard) und der intestinale Ultraschall. CRP und Symptom-basierte Scores sowie hämatologische Indizes kommen erst später. Das Calprotectin ist besser als die Klinik, die nicht sehr zuverlässig ist. Die Gastroenterologen halten sich an die Europäischen Guidelines. Die Endoskopie wird bei neu auftretenden Symptomen oder bei Therapiewechsel gemacht. Die Betreuung während der Remission ist alle 3-6 Monate empfohlen. Die Messung des fäkalen Calprotectins wird empfohlen, da es einen Relapse voraussagt. Der Schub ist einfacher zu behandeln, wenn er früh erkannt wird. Die Klinik ist aber immer noch entscheidend. Man würde keine Therapieeskalation durchführen ohne entsprechende Klinik.
Das Calprotectin ist sehr wahrscheinlich ein Bestandteil des angeborenen Immunsystems. Es scheidet Eisen aus und wirkt dadurch antibakteriell. Das Calprotectin kann deshalb hoch sein, wenn Blut im Stuhl ist. Eine Ulcuskrankheit oder eine virale Gastroenteritis kann deshalb auch zu erhöhten Calprotectin-Werten führen. Das Calprotectin ist also nicht sehr spezifisch. Das Calprotectin hilft sogar quantitativ, gewisse klinische Entscheidungen zu treffen, vorausgesetzt, dass es ist nicht falsch positiv ist. Bei Calprotectin unter 100 ist keine relevante mukosale Inflammation vorhanden. Calprotectin-Werte zwischen 100 und 250 sind im Graubereich. Hier ist es möglich, dass eine residuelle Inflammation besteht: diese Patienten müssen gut überwacht werden. Werte über 250 zeigen, dass eine bedeutende Entzündung besteht. Diese Patienten eignen sich für eine Dünndarmsonographie. Die Dünndarmsonographie ist sehr genau, sie ist kosteneffizient und eignet sich sehr gut zum Überwachen des Ansprechens auf eine Therapie. Es gibt verschiedene Schnittstellen zwischen Hausärzten und Spezialisten beim Umgang mit M. Crohn: das Therapiemonitoring (Lymphozyten (Azathioprin, Ozanimod), Talspiegel (TDM), Medikamentenantikörper (ADA), Transaminasen, Impfungen (Herpes Zoster, Pneumokokken, Influenza…), Kontrolle Integument unter Immunsuppression, Diagnose und Substitution von Fe-, Vitamin D- und Vitamin B12-Mangel.
Beratung beim Nikotinstopp ist sehr wichtig.
Fazit
– Der Crohn Patient in Remission ist ein ideales Beispiel für
eine gute Zusammenarbeit zwischen Allgemeinmedizin und Spezialgebiet
– Chance für optimale/ganzheitliche Betreuung
– Diverse Schnittstellen und diverse Herausforderungen
– Koordination
– Konstanz
– Voraussetzung
– Effiziente Kommunikation
Quelle: Fortbildung «4 Diagnosen – 1 Ziel» des Stadtspitals Zürich und der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich am 2. Februar 2023, organisiert durch Medworld AG
riesen@medinfo-verlag.ch






