- Ludwig van Beethoven: «Meine Ohren, die sausen und brausen»
Der Komponist Ludwig van Beethoven litt zeitlebens an zahlreichen Gebrechen und Krankheiten, unter anderem an seinem schwindenden Gehör. Generationen von Biografen und Medizinern stritten sich über die Frage, was die schon früh einsetzende Taubheit herbeiführte und wie die von Wassersucht begleitete Leberverhärtung entstanden war, die den Tod des 57-Jährigen herbeiführte.
Der deutsche Komponist und Pianist führte die Wiener Klassik zu ihrer höchsten Entwicklung und bereitete der Musik der Romantik ihren Weg. Beethoven wird zu den überragenden Komponisten der Musikgeschichte gezählt. Sein genaues Geburtsdatum ist nicht bekannt, dafür ist seine Krankengeschichte gut dokumentiert. Aus zahlreichen Briefen an Freunde und Ärzte, Notizen und 400 Konversationsheften, mit denen sich der taube Komponist am Schluss verständigte.
Als Kind erkrankte Beethoven an Pocken, die sein Gesicht mit Narben überzogen haben. Mit 17 Jahren litt er unter einer schweren «Unpässlichkeit», wie er im ältesten erhaltenen Brief aus dem Jahr 1787 schrieb. Zeit seines Lebens machten ihm Koliken und Durchfälle zu schaffen. Andauernd hatte er Erkältungen, die auch auf seine sorglose Lebensweise zurückgeführt wurden. Seine Ärzte vermerkten bekümmert das Temperament des ungestümen Patienten, der während der Arbeit aufsprang, sich eilends eine Kanne kalten Wassers über den erhitzten Kopf schüttete und dann wieder, ohne sich abzutrocknen, an seine Noten stürzte.
In den zahlreichen Quellen, Briefen, zeitgenössischen Berichten, Konversationsheften, Obduktionsbefunden und der medizinischen Beethoven-Literatur werden zahlreiche Beschwerden wie Erkältungen, Durchfall, Leibschmerzen, Koliken, Fieberzustände und Entzündungen genannt. Als Ursachen wurden von den Ärzten akute sowie mehrere chronische Erkrankungen in Betracht gezogen. Unter anderem wurden Typhus, Gelbsucht, Bleivergiftung, Brucellose, Lues erwähnt.
In seiner umfassenden Pathographie, die er nach zehnjähriger Forschungsarbeit fertig gestellt hatte und 1950 als Dissertation bei der Universität Frankfurt einreichte, führte der Arzt Dr. Walther Forster Beethovens Leiden auf eine frühe Infektionskrankheit zurück, vermutlich Bauchtyphus, von der sich die Darmorgane des Komponisten nie wieder ganz erholten. Die im nicht funktionierenden Darm entstandenen Gifte, so Forster, wirkten auf den Gehörgang und lösten dort im Lauf der Jahre eine Innenohrentzündung aus. Aus den chronisch gestörten Darmfunktionen entwickelte sich laut Forster auch die Leberzirrhose, die mit der Wassersucht den Tod herbeiführte.
Ludwig van Beethoven stammte aus einer niederdeutschen ursprünglich aus den Niederlanden eingewanderten Kunsthandwerker- und Künstlerfamilie. Grossmutter und Vater waren Trinker, die Mutter und ein Bruder starben an Tuberkulose. Dr. Forster beschrieb Ludwig van Beethoven als pyknisch-athletischen Typus: «Kräftig, fast plump… von gedrungener Gestalt mit breiten Schultern, er hatte einen kugelförmigen Kopf mit wundervoll weitgewölbter Stirn und einen kurzen Hals.»
Mit 48 war der Musiker völlig taub
1798, als Beethoven 28 Jahre alt war, kündigte sich das Gehörleiden an. Ab 1800 wurde Beethoven deswegen auf verschiedene Weise behandelt. 1801 schrieb er einem Freund: «Wisse, dass mir der edelste Teil, mein Gehör, sehr abgenommen hat, schon damals, als Du noch bei mir warst (1798/99) fühlte ich davon Spuren und ich verschwiegs. Es soll von den Umständen meines Unterleibs herrühren.»
Jahrelang versuchte Beethoven sein Ohrleiden geheim zu halten. Im 19. Jahrhundert galten Taube als dumm und lächerlich. Nur gegenüber Freunden klagte er über das ständige «Sausen und Brausen». Oft wechselte er die Ärzte, auf deren Rat nahm er verschiedene «heilende» Teesorten und allerlei vermeintlich lindernde Tropfen, stopfte sich Baumwolle mit Mandelöl oder Meerrettich in die Ohren, nahm lauwarme Donaubäder, versuchte es mit so genannten Vesikatorien, die zu Blasen auf der Haut führten. Man hoffte, dass mit dem Verschwinden der Blasen auch die Krankheit vergehe. Auch den damals gerade entdeckten Galvanismus hoffte er für therapeutische Zwecke nutzen zu können, liess sich Drähte in die Ohren legen und sich von Stromstössen malträtieren.
Von 1799 bis 1812 entstanden trotz des «Sausens und Brausens» und der immer wiederkehrenden Koliken und Fieberanfällen acht grosse Symphonien, darunter die «Eroica» (1804) und die «Pastorale» (1808), die Musik zu Goethes «Egmont» sowie die Oper «Fidelio (1805 bis 1814) und die berühmtesten Konzerte, Klavier- und Violinsonaten (Mondscheinsonate, Appassionata, Kreutzersonate).
Der Erfinder des Metronoms, Johann Nepomuk Mälzel, konstruierte vier Hörmaschinen für den Komponisten, die ihm zeitweise halfen. Dennoch waren die Klavierkonzerte, die Beethoven gelegentlich noch gab, dem verwöhnten Wiener Publikum keine reine Freude mehr. Der Komponist Ludwig Spohr (1784 – 1859) erinnerte sich: «Ein Genuss war’s nicht, denn erstlich stimmte das Pianoforte sehr schlecht, was Beethoven wenig kümmerte, da er ohnehin nichts davon hörte und zweitens war von der früher so bewunderten Virtuosität des Künstlers infolge der Taubheit fast gar nichts übriggeblieben. Im Forte schlug der arme Taube so darauf, dass die Saiten klirrten, und im Piano spielte er wieder so zart, dass ganze Tongruppen ausblieben.»
Beethoven hatte sich mit seinem Geschick abgefunden, obwohl sich sein Leiden immer mehr verschlimmerte. Neben der Taubheit, den Koliken, rheumatischen Anfällen wurde eine Gelbsucht diagnostiziert und ein «Augenübel». Beethoven war schon lange stark kurzsichtig. Er trug Sehgläser von 1,5 bis vier Dioptrien. 1825 zwang ihn wieder eine schwere «Gedärmentzündung» aufs Krankenlager. Er glich einem Greis, dabei war er erst 55 Jahre alt.
In den letzten Lebenswochen vor seinem Tod herrschte an seinem Krankenlager reger Betrieb. Täglich kamen mindestens zwei Ärzte auf Visite sowie zahlreiche Freunde und Bekannte. Auch der Komponist und Schriftsteller Ferdinand Hiller besuchte Beethoven mehrmals, zuletzt am 23. März 1827, am gleichen Tag, als Beethoven sein Testament machte. Hiller schrieb: «Matt und elend lag er da, zuweilen tief seufzend, kein Wort mehr entfiel seinen Lippen – der Schweiss stand ihm auf der Stirn. Der behandelnde Arzt, der in Wien berühmte und gefeierte Dr. Johann Malfatti, verabreichte dem Todkranken Punscheis, um ihm seine letzten Tage angenehmer zu gestalten. Am Abend des 24. März begann sein Todeskampf, der mit Unterbrechungen bis zum 26. März andauerte. Zwei Freunde berichteten: «Gegen 6 Uhr nachmittags brach ein schweres Gewitter herein. Ein Blitz zündete in der Nähe, das Haus erbebte. Da richtete sich der Sterbende auf und hielt drohend die Faust empor. Darauf fiel er zurück. Beethoven war tot.»
Unzählige Diagnosen nach dem Tod
Beethoven wurde am Tag nach seinem Tod in seinem Zimmer obduziert und am 29. März 1827 auf dem Zentralfriedhof Wien beerdigt. Zur weiteren Ermittlung seiner Todesursache wurde seine Leiche 1863 exhumiert und ein zweites Mal 60 Jahre nach seinem Ableben. Bis ins 21. Jahrhundert suchten Forscher in Europa und Amerika mit neuen Methoden nach den Ursachen von Beethovens Krankheiten. Über Beethovens Taubheit erklärte der HNO-Arzt Bernhard Richter vom Freiburger Institut für Musikermedizin: «Eine endgültige Klarheit wird man nie erreichen.» Denn die entscheidenden Knochen des Schädels Beethovens, die Felsenbeine, in denen sich die Gehörschnecke befindet, können leider nicht mehr untersucht werden, so Richter an dem von ihm organisierten Symposium im Jahr 2020 anlässlich des 250. Tauftags von Beethoven an dessen Geburtsort Bonn.
Professor William Meredith vom Beethoven-Zentrum der Universität von San Jose in Kalifornien liess zwei Stücke des Schädels, die im Besitz des Beethoven-Zentrums waren, am Pfeifer Behandlungszentrum in Illinois untersuchen. Der Experte für Spurenelemente und Vitamine, William Walsh, liess sie am Argonne National Laboratory in Illinois mit einem der stärksten Röntgenlaser der Welt analysieren. Die Röntgenstrahlen sind so intensiv und lassen sich so fein fokussieren, dass sie eine zerstörungsfreie Analyse der Elemente ermöglichen. William Walsh: «Wir haben uns besonders für Quecksilber interessiert. Seit fünfzig Jahren gibt es die Theorie, dass Beethovens Symptome von einer Lues stammen würden. Zu seiner Zeit wurde Syphilis mit Quecksilber behandelt, aber wir konnten nicht einmal Spuren von Quecksilber nachweisen. Wir sind also glücklich belegen zu können, dass er nicht an Syphilis litt.»
Eine der Ursachen für Beethovens Beschwerden könnte dagegen eine Bleivergiftung sein, erklärt William Walsh. Der untersuchte Knochen und das Haar von Beethoven enthalten Blei in hoher Konzentration. «Wir haben 20‘000 Patienten untersucht und bei allen den Bleigehalt im Blut und den Haaren gemessen. Darunter waren nur acht Menschen, die vergleichbare Bleiwerte hatten. Alle acht sind schwer krank und ihre Symptome ähneln denen von Beethoven.»
Woher stammten die hohen Bleiwerte des Meisters? Zu Beethovens Zeit gab es Wasserrohre aus Blei, Trinkbecher aus Zinn, das mit Blei verunreinigt war. Vor allem: Beethoven war für seine Vorliebe für Wein bekannt, der im 19. Jahrhundert mit Blei versetzt wurde, um ihm den bitteren Geschmack zu nehmen.
Schon als 11-Jähriger flüchtete Beethoven vor dem gewalttätigen Vater ins Wirtshaus, wo er mit Bier und Wein in Kontakt kam. Noch am Sterbebett fragten ihn Besucher via Konversationsheft, ob er auch genügend Wein habe. Der erste Sektionsarzt, Johann Wagner, notierte in seinem Obduktionsbericht vom 26. März 1827, Beethoven sei an Leberzirrhose und Pankreatitis durch jahrelangen Alkoholgenuss gestorben. Die Hörnerven waren «zusammengeschrumpft und marklos», stellte Wagner fest.
Der Mediziner und Musikwissenschaftler Franz Hermann Franken schrieb: «Beethoven gehört zu den unbegreiflichen Wundern unserer Welt, vor denen wir nur staunend stehen können und vor denen jede Kritik schweigt: Aus einer über Generationen belasteten Trinkerfamilie stammend, von deren Kindern man glaubt, es könne ohnehin nichts aus ihnen werden, zählt er zu den grössten Genies, die je über die Erde gingen.»
Jörg Weber
Quellen: Richter, Holzgreve, Spahn: Ludwig van Beethoven – Der Gehörte und der Gehörlose. Herder, Freiburg i.Breisgau, 2020
Alessandra Comini: Zur Geburt eines Mythos,Hollitzer Verlag, Wien 2020 Walther Forster: Beethovens Krankheiten und ihre Beurteilung. Breitkopf und Härtel, Wiesbaden Deutsches Ärzteblatt, 42/2002
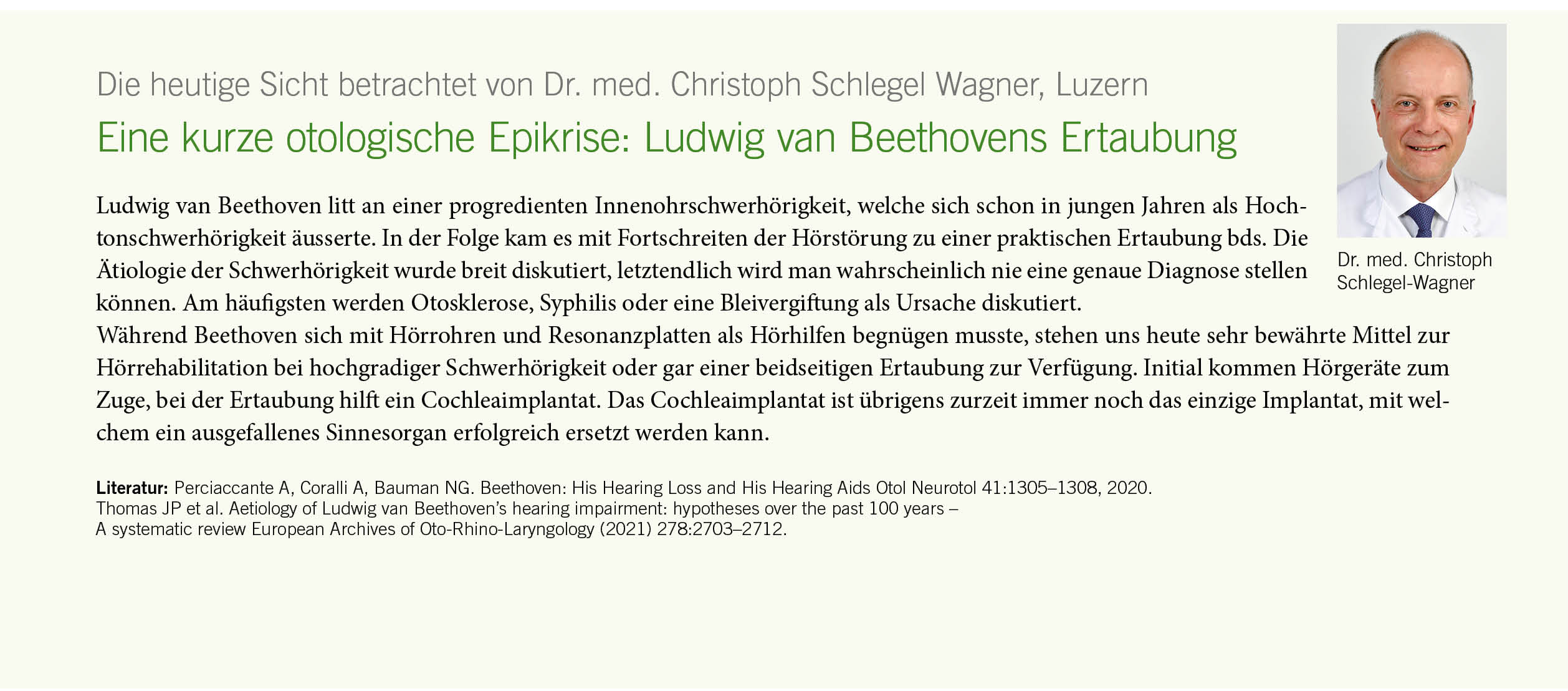
Klinik für Hals-Nasen-Ohren- und Gesichtschirurgie (HNO)
Luzerner Kantonsspital
Spitalstrasse
6004 Luzern
christoph.schlegel@luks.ch
Literatur: Perciaccante A, Coralli A, Bauman NG. Beethoven: His Hearing Loss and His Hearing Aids Otol Neurotol 41:1305–1308, 2020.
Thomas JP et al. Aetiology of Ludwig van Beethoven’s hearing impairment: hypotheses over the past 100 years – A systematic review European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (2021) 278:2703–2712.
der informierte @rzt
- Vol. 13
- Ausgabe 4
- April 2023






