- Reanimationsentscheid – Lebenserhaltung ist als Begriff treffender als Lebensverlängerung
Jedes Leben endet in einem Kreislaufstillstand. Der Zeitpunkt ist unsicher, es geht um Wahrscheinlichkeiten, die sich oft im Verlauf einer bekannten Krankheit abzeichnen. Je fragiler und je älter ein Patient ist, desto wichtiger ist es, den Reanimationsentscheid zu thematisieren, insbesondere in «Schwellensituationen» z.B. Schub einer chronischen Erkrankung, Hospitalisation oder Übertritt ins Pflegeheim. Jede urteilsfähige Person hat das Recht, sich für oder gegen eine Reanimation auszusprechen. Sie kann Reanimationsbemühungen auch dann ablehnen, wenn aus medizinischer Sicht die Prognose günstig ist. Reanimationsmassnahmen, die aussichtslos sind, können hingegen nicht eingefordert werden.
In den letzten zehn Jahren hat der Anteil erfolgreicher Reanimationen mit gutem neurologischem Ergebnis sowohl im Spital als auch ausserhalb des Spitals signifikant zugenommen, im prähospitalen Setting von 8.5% auf 20% (mit initial schockbarem Rhythmus auf 40%). In derSchweiz liegen diesbezüglich keine verlässlichen Daten/Register vor. Trotz geographischen und epidemiologischen Unterschieden lassen sich aber die Erhebungen aus den USA, Australien und Deutschland zumindest ansatzweise auch auf unsere Verhältnisse übertragen. Sehr hilfreich ist, dass die Faktoren, welche eine statistisch relevante ungünstige Auswirkung auf das Ergebnis eines Reanimationsversuchs haben, ebenfalls vorliegen: Metastasierendes Karzinom oder hämatologisches Malignom, Anämie (Hk < 35%), mehr als zwei aktive Co-Morbiditäten, Alter > 75 Jahre, Beeinträchtigung mentaler Status und Einschränkungen bei Aktivitäten des täglichen Lebens (ausgenommen Menschen mit Behinderung) etc. Liegen mehrere Faktoren vor, erhöht sich das Risiko einer neurologischen Beeinträchtigung zusätzlich.
Aktuell wird bei den Patienten routinemässig und gewissenhaft bei Spital- oder Pflegeheimeintritt der Reanimations-Wunsch erfragt. In mancher Situation ist ein solches Gespräch (oft unter Zeitdruck auf der Notfallstation) für alle Beteiligten mehr belastend als Früchte tragend. Ich begrüsse daher sehr, dass die Richtlinien festhalten, dass wenn das Therapieziel eine Reanimation ausschliesst, das Thema Reanimation nicht explizit besprochen werden muss. Zahlreiche Studien zeigen, dass Reanimationsmassnahmen bei hochbetagten und fragilen Personen meist aussichtslos sind. Zudem existiert eine gute Evidenz, dass ein Grossteil der hochbetagten und fragilen Patienten am Lebensende palliative Massnahmen wünscht.
Der Hinweis, im Patientengespräch besser von einem «Reanimationsversuch» als von «Reanimation» und «lebenserhaltenden» anstelle von «lebensverlängernden» Massnahmen zu sprechen gefällt mir sehr gut. Diese sprachlichen Nuancen sind treffender und im Gespräch einfach praktisch umzusetzen.
Insgesamt möchte ich der SAMW zu diesen hilfreichen und praktischen Richtlinien gratulieren. Ich kann das Studium des 37 Seiten (ohne Anhang) starken Dokuments, welches für alle auf der Homepage der SAMW zur Verfügung steht oder als Broschüre bestellt werden kann, sehr empfehlen. Die Auseinandersetzung mit diesem komplexen Thema zeigt einmal mehr, wie nahe am Leben und aussergewöhnlich spannend unsere Aufgabe rund um die Patientenbetreuung sein kann.
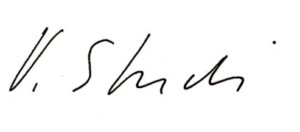
Dr. med. Vera Stucki-Häusler
vera.stucki@hin.ch
Aerzteverlag medinfo AG
Dr. med. Vera Stucki-Häusler
Seestrasse 141
8703 Erlenbach
stucki@medinfo-verlag.ch






