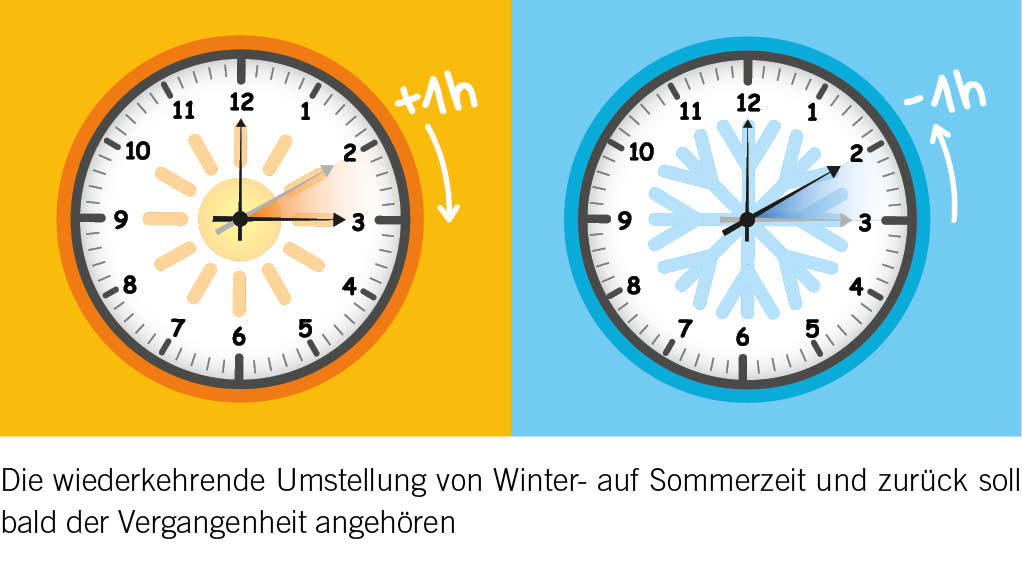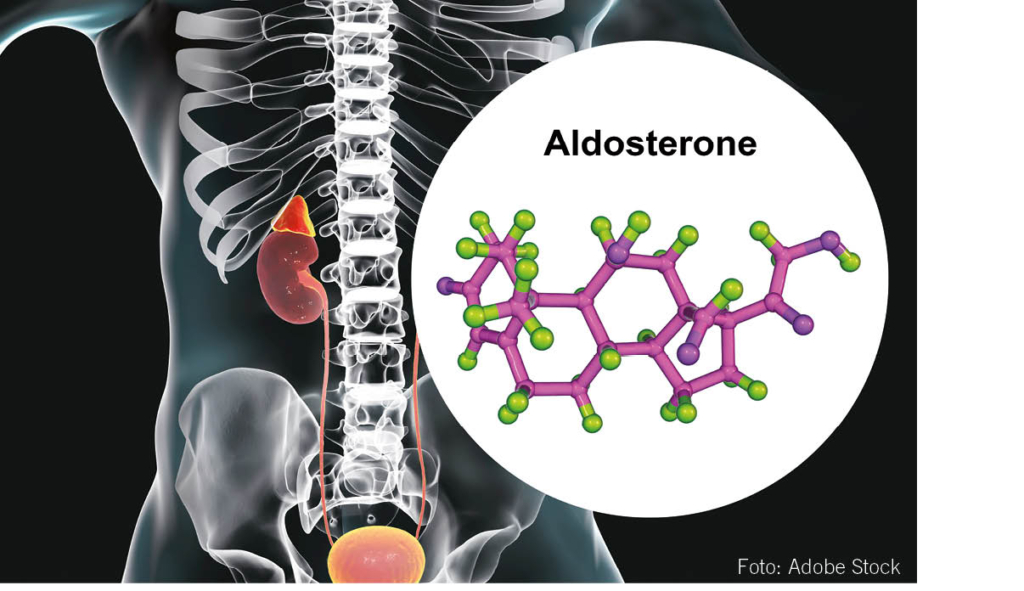- RETO KRAPFs Medical Voice
Frisch ab Presse:
Debatte
Immer Sommerzeit oder immer Winterzeit?
Sie wissen vielleicht, dass am Tag resp. den Tagen nach der Umstellung auf die Sommerzeit mit Schlafdeprivation von etwa einer Stunde kardiovaskuläre Ereignisse, inkl. die damit verursachte Mortalität und Arbeitsplatz-assoziierte Unfälle signifikant (allerdings mit kleiner Effektgrösse) gehäuft sind. Über das Jahr korrigiert sich dies aber, da am Tag nach der Umstellung auf die Winterzeit kardiovaskuläre Ereignisse und Unfälle weniger häufiger auftreten. Nun will man diese Zeitumstellungen, wahrscheinlich ab 2024, nicht mehr. Die Frage ist also: immer Winterzeit oder immer Sommerzeit?
Medizinstimmlich sind die längeren, hellen Abende – wie Umfragen auch in repräsentativen Populationen mehrheitlich zeigen – subjektiv ein Gewinn an Lebenszeit- und Lebensqualität. Nicht so sicher ist, wie sich die «Sommerzeit» im Winter, mit der an den kürzesten Tagen erst um 0900h zu erwartenden Dämmerung anfühlen würde. Viele medizinische Fachgesellschaften argumentieren gegen eine – sozusagen – ganzjährige Sommerzeit: Die längeren Abende und die morgendlichen Dunkelstunden würden zu einer Dissoziation des sozialen, gesellschaftlichen vom individuellen, durch die biologische Uhr verlangten Rhythmus führen. Die innere Uhr wird in der Tat durch den Licht (Sonnen-)Zyklus moduliert. Dieser Dissoziation werden signifikante gesundheitsschädigende Einflüsse wie die bereits erwähnten, aber zusätzlich auch Depressionen zugeschrieben. Für die
perenniale Winterzeit spricht, dass wir uns alle vor dem Hin und Her zwischen Sommer- und Winterzeit schon langfristig an nur eine Zeit, nämlich die Winterzeit, adaptiert hatten.
JAMA 2023, doi:10.1001/jama.2023.0159, verfasst am 09.03.2023
Erfolgsstories für Aldosteron-Antagonisten: Positive Wirkungen auf 1. kardiovaskuläre Ereignisse, 2. Progression der chronischen Niereninsuffizienz und 3. Kontrolle refraktärer Hypertonien
Von den klassischen Aldosteron-Antagonisten wie die steroidalen Spironolakton (Aldakton®) und Eplerenon (Inspra®) war bekannt, dass sie antihypertensive, kardioprotektive und nephroprotektive Eigenschaften aufweisen. Von einem neuen, nicht-steroidalen Antagonist (Finerenon, Kerendia®) wurde gezeigt, dass er kardiovaskuläre Ereignisse bei chronischer Niereninsuffizienz mit oder ohne Diabetes Typ 2 verringert und die Progression der Niereninsuffizienz selber signifikant verlangsamt (1, 2). Während diese 3 Antagonisten den Aldosteron-Rezeptor blockieren (somit die endogenen Aldosteronkonzentrationen erhöhen), blockiert ein neues Medikament (Baxdrostat, ein sogenannter «small molecule inhibitor») ein Enzym der Nebennieren, die sogenannte Aldosteronsynthase. Die erste Evaluation dieses Medikamentes wurde für die refraktäre (oder Therapie-resistente) Hypertonie Plazebo-kontrolliert vorgenommen (3). «Refraktäre Hypertonie» war in dieser Studie wie folgt definiert: Blutdruckwerte > 130/80 mmHg, trotz 3-monatiger Vorbehandlung mit 3 Antihypertensiva unterschiedlicher Wirkungsklassen.
Der Effekt war sehr gross: Mehr als 11 mmHg Reduktion des systolischen Blutdruckes im Vergleich zu Plazebo! Da in Studien in aller Regel auch die Betreuung der PatientInnen in der Plazebogruppe intensiviert wird, ist der Abfall des systolischen Blutdruckes um 9 mmHg in der Plazebogruppe nicht erstaunlich, aber quantitativ überraschend. Baxdrostat ist in der Schweiz noch nicht erhältlich, alle Medikamente mit Interferenz mit der Aldosteronsynthese oder Aldosteronwirkung, so auch die hier erwähnten, können eine Hyperkaliämie verursachen, die aber bei sorgfältiger Beachtung in den Griff bekommen werden kann. Siehe auch nachstehend «Hintergrundswissen in weniger als einer halben Minute»
1. NEJM 2020, DOI: 10.1056/NEJMoa2025845, 2. NEJM 2021, DOI: 10.1056/NEJMoa2110956, 3. NEJM 2023, DOI:10.1056/NEJMoa2213169, verfasst am 05.03.2023
Ikonoklastische klinische Forschung
Ist Hydrochlorothiazid unwirksam in der sekundären Prävention von kalzium-haltigen Nierensteinen?
Patientinnen und Patienten nach Passage eines kalziumhaltigen Nierensteines wird häufig zur Sekundärprophylaxe das Diuretikum Hydrochlorothiazid verschrieben. Eine gut durchgeführte, Plazebo-kontrollierte Schweizer Studie fand – im Gegensatz zu Lehrbuchmeinungen – keinen signifikanten Effekt von 12.5, 25 oder 50 mg Hydrochlorothiazid auf die Nierensteinrezidive. Wieder einmal ein gutes Beispiel dafür, dass wir vieles als gegeben annehmen, das es gar nicht ist. Wie bei jeder chronischen Intervention für eine Krankheit ohne aktuelle Symptome (z.B. bei Osteoporose, Hypertonie u.a.m) war die Compliance weit von der Perfektion entfernt. Die gut siebzigprozentige Befolgung der Therapieanweisungen ist zwar nicht schlecht und im Rahmen, was in solchen Situationen und auch gemäss anderen Studien generell zu erwarten ist. Dass mehr als 25% der Studienteilnehmer die Medikamente nicht oder nicht korrekt einnahmen, könnte aber zu einer Unterschätzung des Hydrochlorothiazideffektes geführt haben. Diese Complianceprobleme dürften aber auch in der Praxis in vergleichbarem Masse vorhanden sein. Für eine weisse, vorwiegend männliche Schweizer Bevölkerung (die Hauptpopulation in dieser Studie) gibt es aber auf Grund dieser Resultate wenig Grund auch in Zukunft generell Hydrochlorothiazid weiter zur Rezidivprophylaxe von kalziumhaltigen Nierensteinen zu verschreiben.
NEJM 2023, DOI: 10.1056/NEJMoa2209275, verfasst am 09.03.2023
Hintergrundswissen: In weniger als einer halben Minute ….
Aldosteron: Lebensversicherung und Übeltäter!
Aldosteron, in der zona glomerulosa der Nebennierenrinde als Antwort auf einen Salz- oder Volumenmangel (via Angiotensin II) oder auf einen Anstieg des Plasmakaliums gebildet, ist überlebenswichtig: Es diktiert der Niere (und dem Kolon sowie den Schweiss- und Speicheldrüsen) Natrium (im Sammelrohr) rückzuresorbieren und somit z.B. in den Sommermonaten, nach Schwitzen beim Sport oder extrarenalen Salzverlusten wie beim Erbrechen oder Durchfall, das Extrazellulärvolumen und den Blutdruck so weit wie möglich konstant zu halten. Aldosteron ist auch unsere Lebensversicherung gegen bedrohliche Hyperkaliämien, denn in den sog. mineralokortikoidsensitiven Geweben (die oben erwähnten Sammelrohre der Nieren, das Kolon sowie die Schweiss- und Speicheldrüsen) führt Aldosteron zu einer erhöhten Kaliumsekretion (oder –elimination). Minime Schwankungen des Plasmakaliums (bei ca 0,1 mmol/L) können signifikante Änderungen der Aldosteronsekretion induzieren!
Die vorhin erwähnten mineralokortikoiden Gewebe, sind die klassischen Zielorgane des Aldosterons. Dieses hat aber auch nicht-klassische «Zielscheiben», nämlich u.a. Endothelien, glatte Gefässmuskelzellen, Entzündungszellen und Bindegewebe-produzierende Zellen (Fibroblasten).
Der Netto-Effekt dieser Aldosteronwirkungen ist ein entzündlicher, profibrotischer Zustand. Aldosteron ist selbst bei Normokaliämie und Euvolämie in diversen klinischen Situationen – leider aus noch wenig definierten Gründen – erhöht. Dazu gehören namentlich die chronische Niereninsuffizienz, schon in frühen Stadien, und die essentielle Hypertonie. Die positiven Effekte der Hemmung der Aldosteronaktivität, sei es durch Rezeptorantagonisten oder Synthesehemmung sind starke Argumente für diese «nicht-klassischen» Aldosteroneffekte. Wir sind gespannt, ob der Aldosteron-Synthase Hemmer (Baxodrostat und allfällige Folgeprodukte) seine Schutzwirkung auch gegen kardiovaskuläre Ereignisse und die Progression der chronischen Niereninsuffizienz beweisen kann, wie wir es auf Grund des Gesagten eigentlich erwarten würden.
Und zum Schluss: Warum wirkt ein Aldosteron-Synthase-Hemmer anscheinend stärker als Aldosteron-Rezeptor-Antagonisten (siehe den unerwartet hohen Blutdruckeffekt des Aldosteron-Synthase-Hemmers Baxdrostat)? Bei Rezeptor-Antagonisten wird die Aldosteron-Konzentration steigen, weil dieses ja weiterhin seine Aufgabe erfüllen will. Die Restaktivität am Rezeptor wird also mutmasslich nie ganz Null sein, sondern dadurch bestimmt, wieviele Aldosteronmoleküle durch die gegebene Konzentration des Antagonisten vom Rezeptor verdrängt werden. Die Hemmung der Aldosteron-Synthese andererseits kann theoretisch die Restsynthese auf Null hinunterschrauben.
Verfasst am 12.03.2023
Medizinische Krimis
1. Havanna-Syndrom
Über Monate wurde über eigenartige Symptome bei Angestellten der US-Botschaft in Havanna (Kuba) berichtet, die sich in einem anderweitig nicht erklärten Symptomenkomplex von u.a. Konzentrationsstörungen, Schlaflosigkeit, Hörverlust, Schwindel und Kopfschmerzen äusserten. Dieses schnell «Havannasyndrom» genannte Phänomen wurde nicht näher bezeichneten, aber bekannten «Schurkenstaaten» angelastet, wobei namentlich eine Ultrabeschallung vermutet wurde. Diese Woche gaben amerikanische Geheimdienste Entwarnung, das Phänomen sucht also eine andere Erklärung oder Ursache.
2. Ursprung der Pandemie
Das FBI andererseits favorisiert neu – wie wir schon seit längerem – von den zwei möglichen Ursachen der Pandemieentstehung die Entweichung eines manipulierten, mutierten Coronavirus aus einem Labor für experimentelle Mikrobiologie in Wuhan. Dies gegenüber der Alternative einer Übertragung von SARS-CoV-2 aus einem tierischen Reservoir in einem hygienisch bedenklichen Wuhan Nahrungsmittelmarkt. Das FBI glättet gleich die Wogen wieder etwas und hält fest, dass es sich nicht um eine Entwicklung einer biologischen Waffe (?) gehandelt habe. Mit 7 Millionen Todesfällen würde sich China ja auch einer sehr teuren Verursacherrolle schuldig machen, aber auf Grund der globalen Kräfteverhältnisse gleichwohl nicht für die astronomischen Kosten der Pandemie zahlen (müssen) und wie bei anderen Gelegenheiten üblich andere Länder inkriminieren. Da die USA das genannte Labor mit Forschungsförderung unterstützten, sind sie allerdings selber auch nicht aus dem Schneider.
3. Todesursache von Pablo Neruda
Im Verlaufe des Pinochet-Putsches 1973 mit Stürmung des Präsidentenpalastes hatte sich der linke Staatpräsident, Salvador Allende, suizidiert. Sein Freund, Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda, wollte aus Chile fliehen. Kurz davor wurde er durch die revolutionierenden Militäreinheiten aufgegriffen und in ein Spital eingeliefert und starb kurz darauf, offiziell wegen einem metastasierenden Prostatakarzinom und Unterernährung. Gemäss Resultaten einer erneuten gerichtsmedizinischen Untersuchung nach Exhumierung vor 10 Jahren, die nun öffentlich wurden, wurde Neruda jedoch durch eine Botulinus-Toxin Applikation ermordet. Die lange Zeit seit der Tat und die vielen Kratzer am Bild des Schriftstellers (u.a. hatte er – von ihm zugegeben – eine tamilische Angestellte vergewaltigt) halten offensichtlich die Empörung darüber etwas unter dem Deckel.
Quellen: verschiedene Tageszeitungen in der Woche des 27. Februar (The Guardian, NZZ, New York Times). Verfasst am 4. März 2023
Grenzgebiete zur Medizin
«Work or Life», «Work and Life» oder gar «Life in Work»?
Das Thema der «Work-Life-Balance» nimmt seit geraumer Zeit in der Medizin einen wichtigen Stellenwert ein, und zwar bei allen Gesundheitsberufen, unbesehen ob die Mitglieder in der Aus- und Weiterbildung engagiert sind oder diese bereits absolviert haben. Cézanne sagte zwar: «Le meilleur des loisirs est toujours encore le travail!» Ein Künstler kann schön darüber reden, werden Sie vielleicht denken. Die gegenwärtige Diskussion zeigt aber, dass vor allem die jüngeren Ärztinnen und Ärzte (1) die Haltung erfahrener Ärztinnen und Ärzte (2) nicht mehr verstehen. Letztere haben ihrerseits etwas Mühe mit den jüngeren Kolleginnen und Kollegen und beklagen auch die verpassten Chancen als Folge einer strikten «Work-Life-Balance» oder besser einer Ab- oder Ausgrenzung des «Lebens» von der «Arbeit». Dankbar dürfen wir zur Kenntnis nehmen, dass das Thema im Sinne der Vermittlung und einem Credo gegen die strikte Abgrenzung der Frei- oder Privatzeit («Life») von der Arbeit («Work») auf das Niveau der Vernünftigkeit, um nicht zu sagen der Vernunft gehoben wurde (3). Ein lesenswerter Artikel! Die moderne Arbeits- und Freizeitwelt ist geprägt durch multiple Möglichkeiten und Angebote und Lebenspläne («embarras de richesse»). Mehr als nur oft treten diese einzelnen Möglichkeiten miteinander in Konflikt und verursachen – wenn sie parallel weiter «gepflegt» werden – Unzufriedenheit und Stress. Wie schaffen wir es wieder, uns auf nur einige wenige Hauptaufgaben zumindest während einer definierten, gegebenen Lebensphase zu konzentrieren? Dass die Inhalte, die Wertschätzung, aber auch die eigene Begeisterung eine solche Aufgabe ausgezeichnet zu erledigen, erfüllt sein müss(t)en, ist selbstredend. Wir alle wissen, dass hier Verbesserungsbedarf besteht….
1. Kellerhals, Tamara, SAEZ 2023; 103(10): 27, 2. Fey, Martin, SAEZ 2023; 103(04): 17-18, 3. Schmid, Birgit, NZZ 2023, Ausgabe 11.03.2023, Seite 40, www.nzz.ch/feuilleton/work-life-balance-trennung-von-leben-und-arbeit-eine-illusion-ld.1729061 (Eine PDF-Version dieses Artikels finden Sie hier – Wir bedanken uns herzlich bei der Autorin, Frau Birgit Schmid, für die Gewährung des Copyrights.) Verfasst am 12.03.2023
krapf@medinfo-verlag.ch