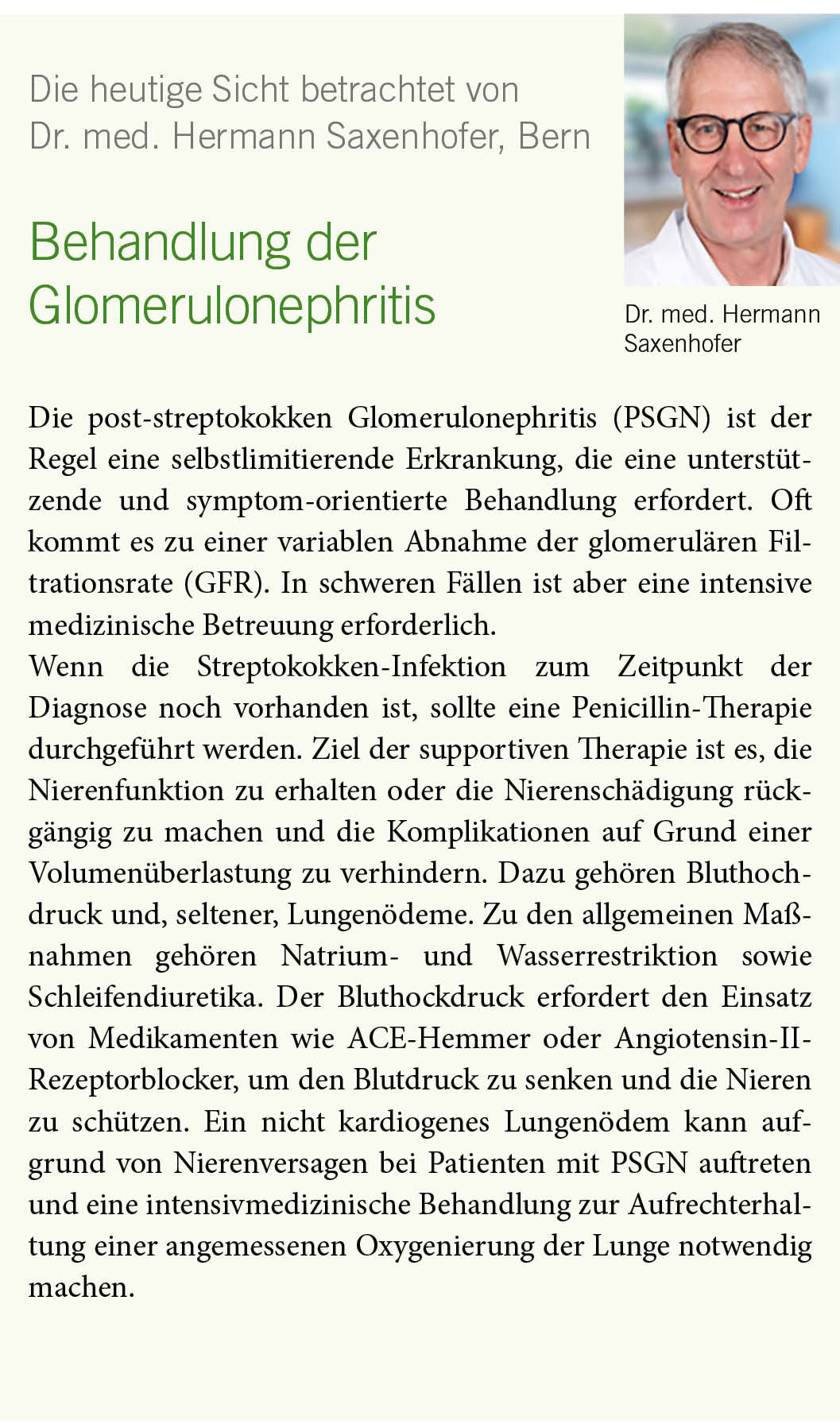- Wolfgang Amadeus Mozart: Dutzende von Theorien über seinen Tod
Der Komponist litt zeitlebens an verschiedensten, zum Teil schweren Krankheiten. Über die Krankheiten, die zu seinem Tod führten, streiten sich Mozart-Biografen und Fachleute bis heute.
Patient: Wolfgang Amadeus Mozart
Geboren: 27. Januar 1756, Salzburg
Gestorben: 5. Dezember 1791, Wien
Am 14. August 1791 schrieb Mozart seinem Vater, er habe vor Schmerzen nicht schlafen können. «Ich muss mich gestern vom vielen Gehen erhitzt und dann unwissend erkältet haben.» Es war das letzte Mal, dass er eine Krankheit brieflich erwähnte. Am 30. September 1791 dirigierte Mozart in Wien die Uraufführung der «Zauberflöte» und in den kommenden Wochen noch etwa
10 Wiederholungen. Gerade einmal neun Wochen nach der Uraufführung erkrankte der Musiker schwer. Am 20. November wurde er bettlägerig. Seine 28-jährige Schwägerin Sophie Haibl hielt an seinem Krankenbett im «Kleinen Kayserhaus» Nr. 970 in der Rauhensteingasse Tag und Nacht Wache. Mozart hatte hohes Fieber und Schmerzen. Er war dünnhäutig und gereizt. Weil er das Trillern seines geliebten Kanarienvogels nicht mehr ertrug, liess er ihn aus dem Zimmer bringen.
In der zweiten Krankheitswoche kamen zu den bisherigen Symptomen Erbrechen und Durchfall hinzu. Sein Körper war angeschwollen, so dass ihm seine Kleider nicht mehr passten. Offenbar sein nahes Ende ahnend, soll er gemäss seiner Frau Constanze gesagt haben: «Ich habe schon Totengeschmack auf der Zunge.» Am 28. November 1791 berieten sich zwei Ärzte am Krankenbett Mozarts, Dr. Thomas Franz Closset, der Hausarzt der Familie und Dr. Matthias von Sallaba, Primar des Wiener Allgemeinen Krankenhauses und Spezialist für Gifte und Vergiftungen (1).
Am 4. Dezember 1791 wurde Dr. Closset zum letzten Mal gerufen. Mozart hatte hohes Fieber und starke Kopfschmerzen. Der Hausarzt wies Mozarts Schwägerin Sophie an, Stirn und Schläfen des Patienten mit Essig und kaltem Wasser zu behandeln. Laut Sophie ging schon beim ersten Kontakt mit der Kälte ein Beben durch Mozarts Körper. Bald darauf fiel er ins Koma, aus dem er nicht mehr erwachte. Am 5. Dezember 1791 um 0.55 Uhr starb Mozart im Alter von nur 35 Jahren, zehn Monaten und acht Tagen. Laut seiner damals 29-jährigen Frau Constanze starb er «zwar gelassen, doch sehr ungern». Als Todesursache Mozarts wurde «hitziges Friesel Fieber» ins Bestattungsbuch der Pfarrei St. Stephan in Wien eingetragen.
Seit seinem Tod gibt es Dutzende von Hypothesen über sein Ableben. Von einer Gehirnhautentzündung war die Rede, Grippe wurde ins Spiel gebracht. Daneben wurden andere mögliche Gründe für seinen Tod vermutet, etwa bakterielle oder parasitäre Infektionskrankheiten. Auch wurde Pharyngitis, eine schwere Rachenentzündung in Betracht gezogen, die zu Krämpfen, Fieber, Ausschlag und Schwellungen am Hals führt.
Seitdem wurde gerätselt und spekuliert, wie er zu Tode gekommen ist. Einige Forscher tippten auf eine Lebensmittelvergiftung. Schweinekotelett, wie in Wien üblich, gehörte zu Mozarts Leibspeise. Es wurde spekuliert, dass Mozart an einer Fleischvergiftung durch trichinenverseuchtes Schweinefleisch gestorben war. Vierundvierzig Tage vor seinem Tod hatte er Constanze in einem Brief mitgeteilt, wie gern er doch Schweinekotelett, sogenannte «Karbonadeln», ass. Auch ein Giftmord wurde nicht ausgeschlossen. Mozart selbst soll gegenüber seiner Frau geäussert haben, von seinem Konkurrenten Antonio Salieri mit Quecksilber vergiftet worden zu sein. Im Gegensatz zum finanziell klammen Mozart war Salieri ein etablierter Liebling am Hofe in Wien.
Der Leidensweg des Wunderkinds
Im Mozartjahr 1956 tauchten die vielfältigen Erklärungen in verschiedenen Gedenkartikeln wieder auf. Der bekannte russische Musikwissenschaftler Belsa behauptete, die Beweiskette sei geschlossen: Mozart sei durch Antonio Salieri vergiftet worden. Der Heidelberger Privatdozent Dr. Dr. Aloys Greither wollte sich mit den verschiedenen, teils abenteuerlichen Hypothesen nicht zufrieden geben und studierte mit wissenschaftlichem Eifer Dutzende von Büchern über Mozart. Das Ergebnis seiner Arbeit veröffentlichte er in einer ausführlichen Studie (2). Greither rekonstruierte den Leidensweg des Wunderkinds. Schon im Alter von sechs Jahren litt Mozart auf einer Reise nach Wien an einer Krankheit, die ihm immer wieder zu schaffen machte: an einem «Katarrh».
Sein kurzes Leben war in Folge seines rastlosen, sich verzehrenden Schöpfertums, eine endlose Kette von Unpässlichkeit, Übermüdung, Gehetztheit, Not, Sorge, Krankheit, schrieb Greither. Als Neunjähriger litt der Komponist an Typhus abdominalis und magerte bis zur Unkenntlichkeit ab. 1768, als Zwölfjähriger, wurde er durch eine der damals schwersten Krankheiten ins Bett gezwungen: durch Pocken. Auf seiner ersten Italienreise (Dezember bis März 1771) erlitt er eine Erfrierung ersten Grades der Hände. Im November 1780 schilderte Mozart in einem Brief: «Ich habe vier Tage nacheinander zur nämlichen Stunde rasende Kolik bekommen, die allzeit mit starkem Erbrechen geendet hat.» Dieser Bericht, meint Dr. Greither, sei überaus wichtig für die Aufklärung der Todesursache: «Für die Bedeutung der tödlichen Krankheit Mozarts, unter Berücksichtigung all der vorausgegangenen rheumatischen und grippösen Infekte, nimmt er eine Schlüsselstellung ein. Hier wird, durch die Koliken, auf das Organ hingewiesen, das seit Jahren (oder Jahrzehnten) latent krank ist (…). Die vier Tage mit sich wiederholenden rasenden Koliken weisen mit Sicherheit auf die Nieren hin (…). Betrachtet man die letzte tödliche Krankheit mit dem Wissen um die lange Vorgeschichte seiner Leiden, so fällt die Diagnose nicht schwer.» Mozart sei seiner chronischen Nierenkrankeit nach einem langen Siechtum im urämischen Koma erlegen, erklärt Dr. Greither.
Neue Hypothese: Glomerulonephritis?
Die Mediziner Richard H. C. Zegers von der Universität Amsterdam und Andrew Streptoe vom University College London sowie dem Wiener Historiker Andreas Weigl stellten kürzlich eine neue Hypothese auf. Die Wissenschaftler vermuten, dass der Komponist an einer bakteriellen Halsentzündung durch Streptokokken erkrankt war. In der Folge habe sich vermutlich eine tödlich verlaufene Nierenentzündung (Glomerulonephritis) eingestellt. Die Forscher fanden Hinweise auf eine entsprechende Epidemie im Wien dieser Zeit.
Der neuen Erklärung für Mozarts Tod liegen umfängliche Analysen der Wiener Sterberegister zugrunde. Ausgewertet wurden die Angaben zu den Todesursachen von Verstorbenen von Dezember 1791 und Januar 1792 sowie die der korrespondierenden Zeiträume in den beiden folgenden Jahren. Die dritthäufigste Todesursache (nach Schwindsucht und Unterernährung) war «Wassersucht», also ein schweres Ödem.
Gemäss den Augenzeugenberichten und den ärztlichen Angaben zu Mozarts Tod in den Totenbeschauprotokollen war dieser in den letzten Tagen stark angeschwollen, hatte Fieber und litt an einem Ausschlag. All diese Symptome begleiten die Glomerulonephritis, die unbehandelt zum Tod führt.
Der Komponist der «Zauberflöte» wurde nicht einmal sechsunddreissig Jahre alt. Von seiner Leiche fehlt jede Spur. Nach seinem Tod bekam der bankrotte Künstler in Wien ein Begräbnis dritter Klasse.
Jörg Weber
Quellen:
1. «Ich bin ein Musikus. Über Mozart. Eine biographische Annäherung.» Thomas O.H. Kaiser, Verlag: BoB Books
2. «Mozart und die Ärzte, seine Krankheiten und sein Tod», Dr. Dr. Aloys Geither, Deutsche Medizinische Wochenschrift, 1956
3. Spiegel Wissenschaft, Februar 2000
Bern