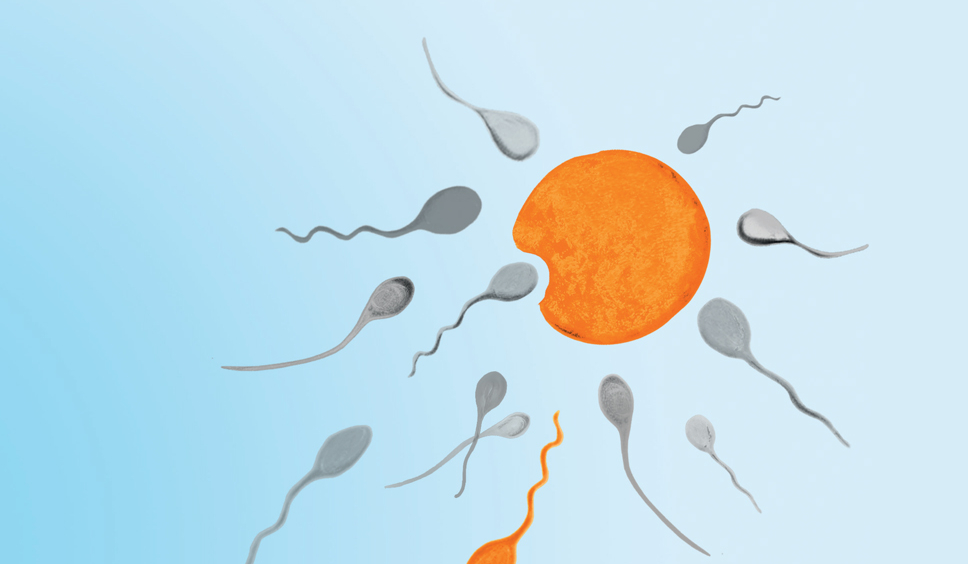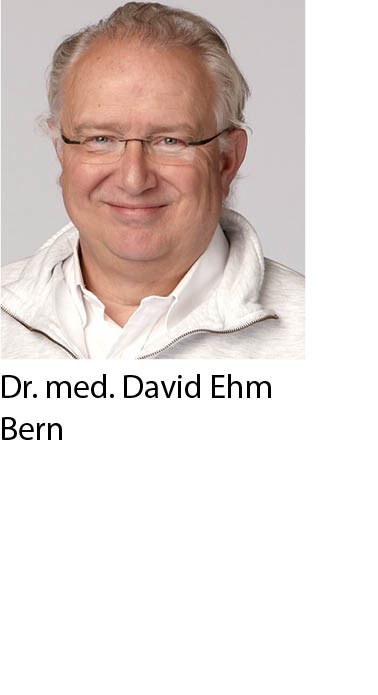- Persönliche Erfahrungen während der aktuellen Pandemie
Irene, wie hast Du die erste und zweite Welle von COVID-19 in der Schwangerschaft in Deiner Klinik in Basel erlebt – gibt es Unterschiede von der ersten zur zweiten Welle?
Auf die erste Welle waren wir trotz direkter Nachrichten und Informationen aus Asien nicht vorbereitetet. Ich war auch erschrocken, dass etwas eintraf, von dem wir theoretisch wussten, aber eigentlich nicht damit gerechnet hatten, dass es auch uns direkt betreffen könnte. Das Erstellen und Hochfahren von Algorithmen oder die Anpassungen bei den Rapporten und Übergaben kam mir manchmal vor, wie eine Mauer aufbauen, um uns und unsere Schwangeren zu schützen, aber auch um Sicherheit zu bekommen. Die Ungewissheit was kommt und wie es unseren Schwangeren aber auch Mitarbeitern ergehen wird, war gross.
Auf die zweite Welle waren wir besser vorbereitet und auch ausgerüstet. Die Algorithmen waren bekannt, mussten allerdings wiederholt angepasst werden. Material war ausreichend vorhanden. So klar die Richtlinien schweizweit bei der ersten Welle waren, so uneinheitlich und unübersichtlich waren und sind sie in der zweiten Welle.
Persönlich fand ich die unterschiedlichen Massnahmen in unseren beiden Halbkantonen ärgerlich und mühsam.
Auch bei den Angehörigen war das Verständnis für Einschränkungen, wie z.B. keine Begleitung bei Schwangerschaftskontrollen, bei der zweiten Welle geringer.
Was waren die grössten Herausforderungen?
Die grösste Herausforderung war der zunächst sehr sparsame Umgang mit dem Material. Das Maskensammeln zum Recycling während der ersten Welle empfand ich als eines der unangenehmsten Dinge. Eine andere Herausforderung war sicher das Aufrechterhalten der Dienstleistung bei plötzlich auftretendem Personalmangel, sei es, dass jemand selbst erkrankte oder auf Covid-Stationen eingesetzt werden musste.
Von akademischer Seite war die Umstellung auf virtuelle Vorlesungen gewöhnungsbedürftig. Der Blick in eine Kamera ersetzt nicht die Interaktion mit den Zuhörern, auch wenn wir zahlenmässig viel mehr teilnehmende Studenten und Fragen hatten. Unsere klinischen Studien waren in der ersten Welle eingestellt, aber wir haben auch gemerkt, dass die Akzeptanz, an einer nicht COVID-19-Studie teilzunehmen, während der Pandemie geringer ist.
Schliesslich fehlen uns auch die direkten Kontakte mit Tansania und Somalila – Orte, an denen sich das USB seit Jahren um eine verbesserte klinische Versorgung für Mutter und Kind einsetzt. Insgesamt besteht die Gefahr, dass die Auswirkung der COVID-19-Pandemie in diesen Ländern grosse negative Auswirkung auf die reproduktive Gesundheit, die Behandlung anderer Infektionskrankheiten wie Malaria oder HIV oder die Aus- und Weiterbildung der Kinder und Jugendlichen haben wird und damit die bereits bestehenden Ungleichheiten noch grösser werden. Dies gilt auch für Katastrophen, wie in Beirut im August 2020, die ja bei uns rasch wieder in Vergessenheit geraten.
Wie war der Outcome Eurer Patientinnen mit COVID 19?
Bei den meisten Schwangeren verlief die COVID-19-Infektion mild, manchmal fast asymptomatisch. Beunruhigend waren zwei Fälle, in denen die Diagnose im Rahmen vorzeitiger Wehen gestellt wurde und bei denen es zu einer akuten Plazentainsuffizienz mit pathologischem CTG, aber doch noch gutem Outcome für Mutter und Kind kam. In beiden Plazenten wurde der sehr eindrückliche Nachweis von einer grossen Anzahl Viruspartikeln erbracht. Gelernt haben wir, dass die Abgrenzung zwischen typischen Symptomen in der Schwangerschaft oder auch unter der Geburt und einer COVID-19- Infektion schwierig ist und damit auch eine COVID-19 Infektion zu Beginn verpasst werden kann.
Welches ist Euer aktueller Approach bei COVID-Patientinnen in der Spätschwangerschaft und Geburt?
Nach Beginn der ersten Welle hatten wir während ca. 6 Wochen ein generelles Screening bei Hospitalisation. Wir fanden dabei weniger als 1% asymptomatisch positiv getestete Schwangere. Zurzeit screenen wir Schwangere bei Symptomen. Bald werden wir kombiniert bei Symptomen einen Schnell-Test und eine PCR durchführen.
Sollten COVID-Patientinnen in der Spätschwangerschaft und Geburt von spezialisierten Zentren behandelt werden?
Schwangere mit einer schweren COVID-19 Infektion sollten in einem Zentrum betreut werden, wo intensiv-medizinische Therapie und Neonatologische Überwachung gleichermassen angeboten werden.
Sollten Ärztinnen den Frauen raten eine Schwangerschaft auf die „Nach-Coronazeit“ zu verschieben?
Ich denke, dass sich einige Paare diese Gedanken bereits gemacht haben im Rahmen ihrer Familienplanung, allerdings ist es etwas schwierig, den Begriff «Nach-Coronazeit» zeitlich genau zu definieren. Persönlich habe ich immer den Eindruck, dass Schwangere sehr viel Eigenverantwortung übernehmen, auf Hygiene achten und kein Risikoverhalten an den Tag legen. Somit schützen sie sich auch vor einer COVID-19-Infektion.
Sind Case-Reports und Literatur über Schwangerschaft und COVID aus China und den USA auf die Schweiz anwendbar?
Im Universitätsspital Basel überblicken wir jetzt ungefähr 30 bis 35 Schwangerschaften, bei denen es zu einer COVID-19 Infektion gekommen ist. Wir selber hatten bisher keine Patientinnen auf der Intensivstation, sondern lediglich auf den Covid-Stationen mit Sauerstoffbedarf und Steroidgaben. Bei den Daten aus den USA mit
3–5-fach höherem Risiko für die Intensivbehandlung fällt auf, dass es Cofaktoren gibt, wie Ethnizität, hoher BMI und grosse soziale Unterschiede, die bei uns nicht so ausgeprägt sind.
Welches sind Deine allgemeinen Erfahrungen und Erkenntnisse?
Geschätzt habe ich den interaktiven Austausch mit unserer psychosomatischen Abteilung: «Care for the Caregivers in Coronazeiten».
Gelernt habe ich aus dem Ganzen, dass wir mehr Verständnis für eine Pandemie aufbringen und wachsamer beobachten müssen, was weltweit passiert. Die Mobilität wird wiederaufleben und damit auch eventuell wieder neue Erkrankungen bringen. Die Corona-Pandemie wird kein Einzelfall bleiben. Ich wurde aber auch darin bestätigt, dass Schutzmassnahmen sehr wohl hilfreich sind und wir in der Schweiz eigentlich damit besser umgehen müssten.
Vielen Dank, Irene, für das interessante Gespräch!