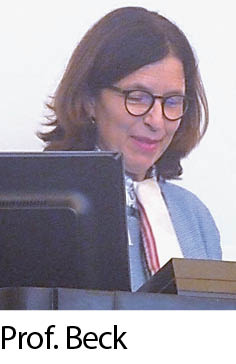- Sex and Gender in Medicine
Brauchen Frauen und Männer jeweils andere Medizin? Gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern in den Krankheitsleitsymptomen oder der Wirkung von Therapien und Medikamenten? Diese Fragen wurden am Symposium über «Sex and Gender in Medicine» diskutiert, das am 15. November in Zürich stattfand.
Das Thema ist noch nicht ganz Mainstream, stellte die Direktorin Frau Prof. Dr. med. Beck-Schimmer, Direktorin Universitäre Medizin, Zürich, einleitend fest. Eine neue Sichtweise auf die Behandlung von Frauen und Männern ist heute angezeigt.
Die Referentin zitierte den französisch-kubanischen Maler und Dichter Francis Picabia: «Unser Kopf ist rund damit das Denken die Richtung wechseln kann».
Durch das Symposium führte in interaktiver und dynamischer Manier Frau Conny Czymoch.
Conny Czymoch, Journalistin und international tätige Moderatorin
Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Interaktion zwischen Herz und Gehirn
Die Anzahl der vaskulären Todesfälle bei Frauen übertreffen heute diejenigen der Männer. 40% der kardiovaskulären Todesfälle werden bei Männern registriert im Vergleich zu 49% bei Frauen, so Frau Prof. Dr. med. Catherine Gebhard, Zürich.
Kardiovaskuläre Risikofaktoren haben eine höhere Prävalenz und eine grössere klinische Bedeutung bei jungen Frauen im Vergleich zu Männern und/oder älteren Frauen und nach einem Herzinfarkt sind Frauen mehr gestresst als Männer. Die Nervenbelastung bei kardiovaskulärer Erkrankung unterscheidet sich bei Männern und Frauen. Bei Frauen wird eine stärkere Reaktion beobachtet, was darauf hindeutet, dass Frauen disproportional anfällig für die negativen psychischen Auswirkungen chronischer Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Die hochregulierte Aktivität der Amygdala ist mit einem erhöhten Entzündungszustand bei weiblichen Patienten verbunden. Ein Fokus auf Entzündungsmarker und Belastungsindikatoren könnte die Ergebnisse bei Frauen mit koronarer Herzkrankheit verbessern.
Zukünftige Studien werden die klinische Bedeutung der neuronalen Bildgebung bei der Phänotypisierung von Patienten mit Risiko für künftige kardiale Ereignisse bewerten müssen, so die Perspektiven der Referentin.
Gibt es nur den «kleinen Unterschied» zwischen Mädchen und Knaben?
Zunächst erinnerte Prof. em. Dr. med.-David Nadal, Zürich, mit dem kleinen Unterschied an Alice Schwartzer vor 40 Jahren.
Der Referent zeigte den genetischen Unterschied zwischen Mädchen und Knaben, die Geschlechts-Chromosomen XX vs. XY, und stellte fest, dass eigentlich die Knaben das schwache Geschlecht darstellen. Er erwähnte den Dresscode mit blau und rosa und das Lied von Herbert Grönemeyer: «Männer führen Kriege Männer sind schon als Baby blau».
Die Unterschiede in Sterblichkeit und Morbidität bei Zwillingen mit unterschiedlichem Sex untermauern, dass Männer eigentlich das schwache Geschlecht darstellen, zumindest medizinisch.
So zeigen sie vermehrte kongenitale Abnormalitäten, höhere neonatale Mortalität vermehrte Häufigkeit von Atemstörungssyndromen. In der Frühkindlichen Entwicklung gibt es geringe Unterschiede in der Feinmotorik, im Sprechen.
Mädchen reden in der Regel einige Wochen früher als Knaben, haben einen grösseren Wortschatz und eignen sich Mamas Mimik und Gestik früher an als Knaben. Bei der Kraftanwendung sind allerdings Knaben früher als Mädchen.
Gender-Stereotypien beeinflussen das Verhalten. So werden hochrangige intellektuelle Fähigkeiten (Brillanz, Genialität, etc.) mehr mit Männern als mit Frauen in Verbindung gebracht. Diese Stereotypien entmutigen Frauen bei der Suche nach prestigeträchtigen Karrieren.
Mädchen und Knaben können – sei es als Neugeborene, Kleinkinder, Schulkinder oder Jugendliche – medizinisch nicht unbedingt über den gleichen Kamm geschoren werden.
Für eine menschenwürdige Medizin braucht es epidemiologische, diagnostische und therapeutische Forschung und Lehre, welche den alters-, sex- und gender-bedingten Unterschieden Rechnung tragen, so die Schlussfolgerungen des Referenten.
Geschlechtsunterschiede und -ähnlichkeiten aus der Perspektive der Neuropsychologie
Die Kernthesen sind: Geschlechtsspezifisches Verhalten wird determiniert durch geschlechtsspezifische Gehirne (Anatomie & Neurophysiologie), Testosteron und Östrogenkonzentration etc. und Genetik, so Prof. Dr. rer. nat. Lutz Jänke, Zürich.
Der Referent erinnerte an das Buch von Allan und Barbara Pease, Warum Männer immer Sex wollen und Frauen von der Liebe träumen. Er nannte die Gebiete, bei denen Frauen im Vorteil und solche, bei denen Männer im Vorteil sind.
Um die Unterschiede mathematisch zu erfassen, definierte er die Effektstärke als Unterschied = (Leistung Männer – Leistung Frauen) / Streuung. Er wies auf die verschiedenen Effektstärken hin, die von 0.9 (Verträglichkeit: Offenheit für Erfahrung) zugunsten von Frauen bis 2.0 für Werfen und Geschwindigkeit zugunsten von Männern reicht. Die durchschnittlichen Effektgrössen zeigen 88% Überlappungen zwischen Männern und Frauen, also praktisch keinen Unterschied. Das für Frauen vielgenannte Multitasking zeigt eine Effektgrösse von weniger als 0.1 (sogar zugunsten von Männern). Der Referent schloss mit dem Zitat von Janet Shibley Hyde «Männer und Frauen sind in den meisten (nicht allen!) psychologischen Funktionen ähnlich bzw. identisch!» (Janet Shibley Hyde. The gender similarities hypothesis. Amer. Psyhologist 2005;60:581-592).
Was ist Gender-Medizin und wie kann sie im klinischen Alltag umgesetzt werden?

Menschen werden weiblich oder männlich geboren, aber lernen Mädchen oder Buben zu sein, welche zu Frauen oder Männern heranwachsen, so Frau Univ. Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer, Wien.
Ein Mann oder eine Frau zu sein, hat einen signifikanten Einfluss auf die Gesundheit, sagt die WHO.
Die Definition von Sex und Gender
Ein Drittel (6500) der untersuchten Gene in Männern und Frauen werden unterschiedlich exprimiert. Gene, welche vor allem in einem Geschlecht aktiv sind, spielen womöglich eine zentrale Rolle in der Evolution und Gesundheit.
Beispiele für geschlechtsspezifisch stärker exprimierte Gene sind bei Männern der Haarwuchs (in der Haut), der Muskelaufbau, Gene in der Brust (vermutlich um die Laktation zu unterdrücken). Bei Frauen sind es die Fettspeicher, Gene in der Leber, die den Metabolismus von Medikamenten beeinflussen, sowie unterschiedliche Gene des Zuckerstoffwechsels.
Gendermedizin: Verhalten und gesundheitliche Belastungen
Frauen nehmen häufiger an Vorsorgeuntersuchungen teil und haben insgesamt mehr medizinische Konsultationen. Männer schätzen dagegen Bewegung eher als gesundheitsfördernd ein. Ernährung spielt wiederum im Gesundheitskonzept von Frauen eine zentrale Rolle.
Rauchen und Alkoholkonsum waren früher männlich dominiert und sind NOCH für einen wesentlichen Teil des Gender-Gaps in der Lebenserwartung verantwortlich.
Pathologische Geschlechter-Unterschiede des Stoffwechsels und Energiehaushalts
Frauen zeigen öfter gestörte Glukosetoleranz und später Diabetes, mehr Adipositas, häufiger auch Depressionen, höheres Risiko für Komplikationen (Herz, Hirn u.a.). Diätetische Hauptrisikofaktoren für Mortalität sind wenig Vollkorn bei Frauen und hoher Salzkonsum bei Männern. Männer weisen eine höhere Mortalität wegen ungesünderer Ernährungsgewohnheiten auf.
Gendermedizin und Medikamente
Frauen sind in klinischen Studien generell unterrepräsentiert, sie zeigen mehr Nebenwirkungen bei ACE-Hemmern, β-Blockern, Ca-Antagonisten, Statinen und mehr Blutungen unter antithrombotischer Therapie. Frauen zeigen eine 10-20% grössere Wahrscheinlichkeit für fehlende Therapieadhärenz. Die Ursachen können geringeres Bewusstsein für kardiovaskuläre Erkrankungen oder mehr Nebenwirkungen sein. Unterschiede wurden auch bei der Behandlung von Patientinnen durch weibliche gegenüber männlichen Ärzten festgestellt. Die Mortalitäts- und Wiederaufnahme-Raten von Patientinnen waren bei Internistinnen geringer als bei Internisten.
Die Referentin schloss mit dem Zitat von Rosa Meyreder, 1905: «Die beiden Geschlechter stehen in einer zu engen Verbindung, sind von einander zu abhängig, als dass Zustände, die das eine treffen, das andere nicht berühren sollten.»
Sex- und Gender-Unterschiede bei Alzheimer-Krankheit – Update des Women’s Brain Project
Frauen weisen im Mittel mehr Neurotismus (vermehrte Ängstlichkeit, niedrigere Stresstoleranz) auf als Männer. Dies mag zu einem höheren Mass an Ängstlichkeit beitragen, von dem Frauen auf Googleghost berichten, und zu der geringeren Anzahl von Frauen in hochbelasteten Berufen, stellte Dr. Maria Teresa Ferretti, Zürich, fest.
35% des Risikos für Alzheimer-Krankheit sind modifizierbar. Sex und Gender beeinflussen die modifizierbaren Risikofaktoren. Spezifisch weibliche potentielle Risikofaktoren sind frühe Menopause, hypertensive Komplikationen während der Schwangerschaft, Schwangerschaften, und Migräne. Bei Frauen wird eine schnellere Krankheitsprogression festgestellt. Es gibt aber auch geschlechtsbedingte Unterschiede bei den Biomarkern für Alzheimer-Krankheit. So zeigen Frauen eine vermehrte Tau-vermittelte metabolische Dysfunktion im Vergleich zu Männern.
Die Referentin rief zum Handeln von der «One size fits all medicine» zur Precision Medicine auf. Dies bedeutet Sex-sensitive Präventionskampagnen, Frühdiagnose, Behandlung sowohl bei präklinischem Studiendesign als auch in der präklinischen Forschung.
Das Women’s Brain Project hat 4 Hauptarbeitsabläufe: W51: präklinische Wissenschaft, W52: Medikamententwicklung, W53: Neue Technologien, W54: Soziale Determinanten der Gesundheits- und Politikwissenschaft.
Geschlecht als biologische Variable in der Grundlagen- und präklinischen Forschung
Das Geschlecht ist eine wichtige biologische Variable in der medizinischen Forschung, stellte Prof. Dr. rer. nat. Thorsten Buch, Zürich, einleitend fest. In der Präklinik kommen oft nur männliche Tiere zum Einsatz. Sind die Geschlechter in der biomedizinischen Forschung gleich?
In der Zellkultur nehmen weibliche Neurone Dopamine zweimal so schnell auf wie männliche Neurone. Weibliche Neurone und Nierenzellen sind empfindlicher gegenüber Chemikalien, die den Zelltod auslösen. Weibliche Leberzellen haben mehr CYP3A-Protein, welches wichtig für den Abbau der Hälfte aller Medikamente ist. Beim Schmerz brauchen männliche Mäuse Mikroglia für mechanisches Schmerzempfinden, weibliche Mäuse brauchen dagegen T-Lymphozyten.
Von 71 Forschungsarbeiten mit Mäusen oder Ratten, die in der Zeitschrift Pain im Jahre 2015 publiziert wurden, waren 56 nur mit Männchen, nur 6 mit Weibchen, 6 Studien erwähnten das Geschlecht überhaupt nicht. Viele Forscher benutzen Männchen statt Weibchen. Die Gründe sind eine mögliche Variabilität aufgrund schwankender Hormonspiegel, die Befürchtung, dass die Gutachter der Studien fordern könnten, dass jede Phase des Östruszyklus zu wiederholen sei. Zudem glauben viele Forscher, dass die Stichprobengrösse verdoppelt werden müsste, was die Kosten für Experimente erheblich erhöht. De vero weisen weibliche Tiere eine geringere Variabilität auf als männliche Tiere, wie der Referent zeigte.
Warum brauchen wir Gendermedizin?
Handlungsfelder an der Universität sind Gender in Klinik, Therapie und Prävention, Gender in der Forschung, Gender in der Lehre, stellte Frau Prof. Dr. med. Vera Regitz-Zagrosek, Berlin, z.Z. Anna Fischer Dückelmann Gastprofessorin an der Universität Zürich, fest. Die Referentin bezog sich insbesondere auf die kardiovaskuläre Forschung.
Junge Frauen zeigen weltweit eine erhöhte Sterblichkeit nach Bypass-Operation. Das klassische Bild der koronaren Herzerkrankung ist ein älterer rauchender Mann. Herzerkrankungen sind aber heute der «Killer Nr. 1» bei Frauen. Männer zeigen die klassischen Erkrankungen der grossen Koronargefässe. Frauen weisen Plaqueerosionen, Spasmen, Dissektionen, Erkrankungen der kleinen Gefässe auf. Sie haben ein grosses Spektrum an Beschwerden und zeigen ein unterschiedliches Ansprechen auf Therapien.
Geschlechterunterschiede gibt es auch bei psychischer Gesundheit/Krankheit. Frauen leiden häufiger an psychischen Krankheiten wie Angsterkrankungen, versuchtem Suizid. Männer zeigen antisoziale Persönlichkeitsstörung, Sucht und vollendeten Suizid. Endokrine und muskuloskelettale Erkrankungen sind bei Frauen häufiger als bei Männern. Die Osteoporose gilt als Frauenerkrankung. Bei Männern wird sie unterschätzt und ist unterdiagnostiziert.
Frauen sind auch bei der COPD überrepräsentiert. Sie weisen die Symptome in jüngerem Alter auf als Männer und bei geringerer Tabakexposition.
Die Prävalenz von kardiometabolischen Störungen bei Frauen und Männern hat weltweit zugenommen und ist mit einem Anstieg von Adipositas und Fettleibigkeit, damit verbundenen Konzentrationen anderer kardiometabolischer Risikofaktoren wie Bluthochdruck, beeinträchtigter Glukosemetabolismus und Dyslipidämie verbunden. Die Referentin ruft zu den folgenden Handlungsfeldern an der Universität auf:
Geschlechtsunterschiede sollen bei allen Erkrankungen und in der Arzneimitteltherapie systematisch aufgearbeitet werden. In der Forschung müssen Geschlechter-Unterschiede in Tiermodellen berücksichtigt werden.
Quelle: Kickoff Symposium «Sex and Gender in Medicine», Universitäres Zentrum Zürich, 15.11.2019.
riesen@medinfo-verlag.ch