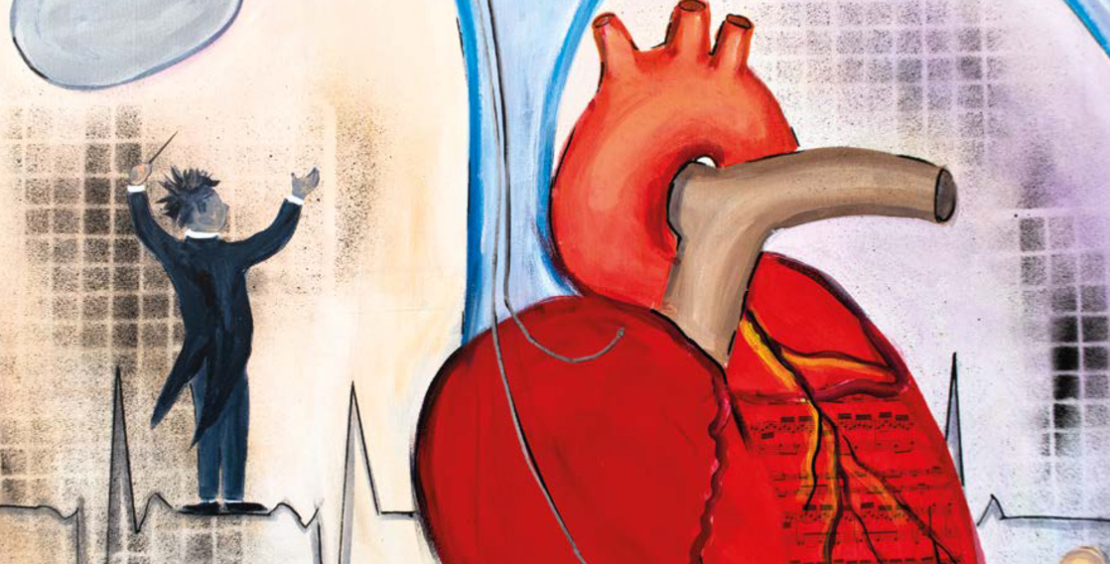- CARDIO FLASH
Spontane Koronardissektion: Neue Erkenntnisse zur Genetik und Pathophysiologie
Die spontane Koronardissektion (SCAD) tritt familiär gehäuft auf. Aber eine klare Vererbbarkeit nach Mendelschen Regeln besteht nicht. Obwohl die SCAD mit fibro-muskulärer Dysplasie, Bindegewebserkrankungen wie dem Ehlers-Danlos Syndrom assoziiert sein kann, wurde eine seltene pathogene genetische Variante für Bindegewebskrankheiten nur in 3% der Betroffenen gefunden. SCAD scheint hauptsächlich eine polygenetische Krankheit zu sein, was durch zwei neue Arbeiten bestätigt wurde. Eine Arbeit verglich 13 Familien mit SCAD (27 betroffen und 12 nicht betroffen Familienmitglieder) sowie 117 Patientinnen mit spontanem SCAD mit 1127 gesunden Kontrollpersonen (1). Bei den SCAD-Patientinnen wurde keine der 68 bekannten seltenen Varianten für Bindegewebserkrankungen gefunden. Vielmehr hat eine Akkumulation von allgemeinen genetischen Risikofaktoren das Auftreten einer SCAD erklärt. Sieben bekannte genetische Nukleotidvarianten waren sowohl bei familiärer SCAD, als auch bei spontaner SCAD deutlich erhöht. Je mehr Varianten vorlagen, umso grösser war die Wahrscheinlichkeit eines SCAD. Jedoch konnte keine Schwelle für das Auftreten einer SCAD identifiziert werden.
Eine genom-weite Assoziationsstudie bei 1917 SCAD Patientinnen und 9292 Kontrollpersonen identifizierte insgesamt 16 genetische Varianten, die in unterschiedlichem Masse zur Entstehung einer SCAD beitrugen (2). Diese genetischen Varianten beeinflussen die glatte Gefässmuskulatur, die Fibroblasten und die extrazelluläre Matrix. Eine pathophysiologisch wichtige Rolle bei der SCAD spielt die Veränderung des Gens für den Gewebefaktor F3, welche das Auftreten eines intramuralen Hämatoms begünstigt. Bei der SCAD entsteht wahrscheinlich zuerst ein intramurales Hämatom, welches durch die erhöhte Wandspannung sekundär zur Dissektion führt. Einige der genetischen Varianten, die zur SCAD führen, sind mit der koronaren Herzkrankheit verbunden, jedoch mit entgegengesetzter Wirkung. Die genetischen Varianten, die zu SCAD führen, sind im Allgemeinen protektiv gegenüber der KHK. Der KHK und der SCAD sind nur genetische Varianten, welche zur Hypertonie führen, gemeinsam. Die kardiovaskulären Risikofaktoren wie Lipidmetabolismus und Diabetes werden durch die genetischen Varianten, die zum SCAD gehören, nicht beeinflusst. Dies passt zur klinischen Beobachtung, dass SCAD Patientinnen keine oder wenige kardiovaskuläre Risikofaktoren aufweisen. Für die Primärprävention oder die Sekundärprävention einer SCAD bedeuten diese Erkenntnisse, dass das Senken des Blutdrucks sinnvoll ist, während das Senken des Cholesterins keinen Nutzen bringt.
Prof. Franz Eberli
1 Tarr I. et al. JAMA Cardiol 2024;9(3):254-261
2 Adlam D. et al. Nature Genetics 2023;55:964-972
Neues zur Behandlung der Hypertriglyzeridämie
Einführung:
Eine erhöhte Konzentration von Triglyceriden zeigt nicht nur eine Erhöhung der freien Triglyceride im Serum an, sondern ist ein Mass für die Summe der zirkulierenden ApoB enthaltenden Triglycerid reichen Lipoproteine (vor allem Chylomikronen und VLDL) (1). Die Ursachen für die erhöhten Triglyceride sind erstens verschiedene Krankheiten (z.b. Diabetes mellitus, metabolisches Syndrom), zweitens genetische Faktoren, welche die Aktivität der Lipoproteinlipase vermindern, oder drittens eine Kombination von beiden.
Von erhöhten Triglyceriden spricht man bei Werten >1,69 mmol/l, von einer moderaten Hypertriglyzeridämie bei Werten zwischen 2,3-5,6 mmol/l, von einer schweren bei 5,7-9,9 mmol/l und von extremer Erhöhung bei >10,0 mmol/l.
Triglyceride lassen sich gut mittels Anpassungen des Lebensstils senken. Dazu gehören Gewichtsreduktion, körperliches Training, Reduktion von Alkoholgenuss und kohlenhydratreicher Ernährung. Bei einem Triglyceridwert von > 2.3 mmol/l empfehlen die europäischen Richtlinien zusätzlich zur lipidsenkenden Therapie mit Statinen ein medikamentöses Senken der Triglyceride zur Verminderung des kardiovaskulären Risikos (2). Ob Triglyceride per se für ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko verantwortlich sind, ist aber nicht sicher. Auf jeden Fall konnte bis jetzt keine Risikoreduktion für kardiovaskuläre Ereignisse durch das Senken der Triglyceride mittels einer medikamentösen Intervention gefunden werden.
Medikamentöse Therapien ohne Wirkung
Niacin brachte in zwei Studien keinen Nutzen, hingegen so viele Nebenwirkungen, dass es nicht mehr eingesetzt wird. Ebenfalls keinen Nutzen hatten die Fibrate. Zwar hat Fenofibrat in der FIELD Studie 2005 die Triglyceride um 29% (3) und in der ACCORD Studie 2010 um 26% gesenkt (4), verbesserte aber das kardiovaskuläre Risiko nicht. In der aktuellsten Studie (PROMINENT Studie 2023) resultierte der Einsatz des neuen Fibrats Pemafibrat in einer Reduktion der Triglyceride um 25%, hatte aber wiederum überhaupt keinen Effekt auf die kardiovaskulären Ereignisse (5). Hoch dosierte Omega-3-Fettsäuren senkten die Triglyceride um 20%, bewirkten aber ebenfalls keine Reduktion von kardiovaskulären Ereignisse (6). Icasopent Ethyl (Vascepa®) hat verglichen mit (einem wahrscheinlich nicht neutralen) Placebo die Ereignisrate zwar reduziert, aber der Effekt war nicht auf das Absenken der Triglyceride zurückzuführen (7).
Neue Therapieansätze
Triglyceride im Blut sinken durch dessen Freisetzen aus den Triglycerid reichen Lipoproteinen durch das Enzym Lipoproteinlipase und der darauf einsetzenden Verwertung als Betriebsstoffe. Zusätzlich werden die Triglycerid reichen Lipoproteine und deren Metaboliten via Leber aus dem Kreislauf entfernt. In beide Prozesse sind die Proteine Apolipoprotein C-III (APOC3) und Angiopoietin-like Protein 3 (ANGPTL3) involviert. Neue Therapieansätze zielen darauf ab, mit genetischen Methoden die Produktion dieser beider Proteine zu reduzieren. Dazu gehören für das APOC3 die antisense Oligonukleotide Vupanorsen und Olezarsen und die small interfering RNA Plozasiran. Für die Inhibition des ANGPTL3 wurde ein humanisierter Antikörper entwickelt (Evinacumab) (1, 8). Vupanorsen kann zu Thrombozytopenien führen und wird deshalb kaum klinisch eingesetzt werden. Soeben sind am ACC Meeting die Studienresultate von Olezarsen und Plozasiran bei Patientinnen und Patienten mit schwerster Hypertriglyzeridämie (>9,9 mmol/L) und von Olezarsen bei Patienten mit moderater Hypertriglyzeridämie und hohem Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse vorgestellt worden. Beim genetisch bedingten familiären Chylomykronämie-Syndrom hat Olezarsen die Triglyceride um 43,5% reduziert und das Auftreten einer Pankreatitis während eines Jahres fast verhindert (9). Ähnliche Resultate zeigte Plozasiran (10). Olezarsen und Plozasiran dürften daher in Zukunft eine Rolle spielen bei der Behandlung der seltenen familiären Hypertriglyzeridämie.
Bei Patienten mit hohem kardiovaskulären Risiko und moderater Hypertriglyzeridämie wurden durch das Olezarsen die Triglyceride um 49-53% gesenkt (11). Gleichzeitig kam es zu einer Abnahme des VLDL, des remnant Cholesterols, des ApoB und Non-HDL. Die LDL Werte veränderten sich nicht signifikant. Ob verglichen mit dem Effekt der Fibrate diese etwa doppelt so starke Senkung der Triglyceride durch das Olezarsen auch wirklich eine Abnahme der kardiovaskulären Ereignisse bringt, ist allerdings nicht sicher. Dafür müssen grosse klinische Studien durchgeführt werden, welche den Nutzen und die Sicherheit des antisense Oleonukleotids Olezarsen im Langzeitverlauf beweisen. Bis diese Evidenz vorliegt, bleibt weiterhin als einzige sinnvolle Massnahme bei erhöhten Triglyzeriden die Änderung des Lebensstils.
Prof. Franz Eberli
1. Mszar R et al. J Clin Med 2023;12:1382
2. Visseren FLJ et al. Eur Heart J 2021;42:3227-3337
3. Keech A et al. Lancet 2005;366:1849-61
4. ACCORD Study group NEJM 2010;362:1563-74
5. Das Pradham A et al. NEJM 2022;387:1923-34
6. Nicholls SJ et al. JAMA 2020;324:2268-80
7. Bhatt DL et al. JACC 2019;74:1159-1161
8. Watts GF, NEJM 2024, DOI: 10.1056/NEJMe2402653
9. Stroes ESG et al. Olezarsen, acute pancreatitis, and familial chylomicronemia syndrome. NEJM 2024, DOI: 10.1056/NEJMoa2400201
10. Gaudet D et al. Plozasiran (ARO-APOC3) for Severe Hypertriglyceridemia:The SHASTA-2 Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol 2024
doi:10.1001/jamacardio.2024.0959
11. Bergmark BA et al. Olezarsen for hypertriglyceridemia in patients at high cardiovascular risk. NEJM 2024, DOI: 10.1056/NEJMoa2402309
Stadtspital Zürich Triemli
Klinik für Kardiologie
Birmensdorferstrasse 497
8063 Zürich
franz.eberli@triemli.zuerich.ch