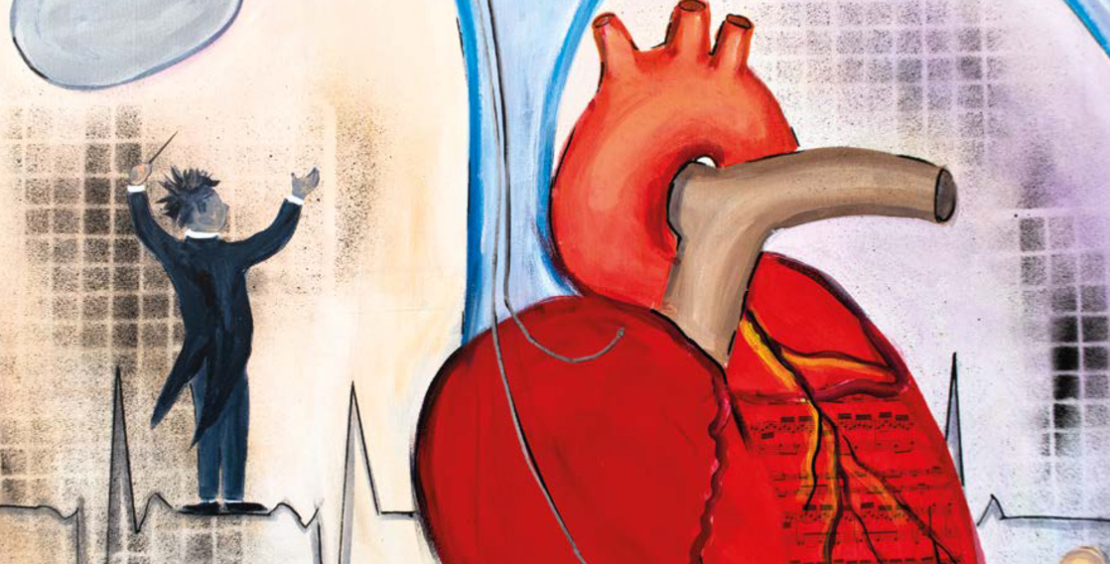- CARDIO FLASH
Adipositas als neues Therapieziel in der Sekundärprävention
Semaglutid senkt kardiovaskuläre Ereignisse bei Adipositas auch ohne Diabetes (SELECT Trial)
Obwohl die Adipositas traditionell nicht zum engsten Kreis der kardiovaskulären Risikofaktoren zählt, sind die indirekten kardiovaskulären Risiken durch Übergewicht bestens bekannt. Entsprechend ist die Idee, Übergewicht zu behandeln, um kardiovaskuläre Komplikationen zu reduzieren, nicht neu. Bereits vor 10 Jahren zeigte die bei Diabetikern durchgeführte «Look AHEAD» Studie (1) eine eindrückliche Gewichtsreduktion (-8%) durch Lebensstilmassnahmen innerhalb der ersten 12 Monate. Da die Mehrheit der Studienteilnehmer die Lebensstilmassnahmen nicht langfristig aufrechterhalten konnte, kam es allerdings im Verlauf zu einer kontinuierlichen Gewichtszunahme in der Interventionsgruppe, sodass der Gewichtsunterschied zur Kontrollgruppe nach 10 Jahren lediglich noch 2.5% betrug und keine Unterschiede bezüglich kardiovaskulärer Ereignisse aufgezeigt werden konnten. Die nun im New England Journal of Medicine publizierte SELECT Studie (2) darf deshalb als bahnbrechend bezeichnet werden, da in SELECT zum ersten Mal bewiesen werden konnte, dass eine durch pharmakologische Therapie unterstütze nachhaltige Gewichtsreduktion bei Übergewichtigen und Adipösen ohne Diabetes zu einer Reduktion von kardiovaskulären Ereignissen (Myokardinfarkt, Hirnschlag und kardiovaskulärer Tod) führt. SELECT untersuchte, ob der GLP-1 Rezeptor Agonist Semaglutid bei Patienten mit Übergewicht oder Adipositas (BMI ≥27 kg/m2), aber ohne Diabetes, vor kardiovaskulären Ereignissen schützt. Insgesamt wurden 17’604 Patienten mit vorbestehenden kardiovaskulären Erkrankungen (vorheriger Herzinfarkt, vorheriger Schlaganfall oder periphere Arterienerkrankung) entweder zu Semaglutid 2.4mg s.c. / Woche oder Plazebo randomisiert. Die durchschnittliche Expositionszeit gegenüber Semaglutid oder Placebo betrug 34,2 ± 13,7 Monate; die durchschnittliche Nachbeobachtungsdauer betrug 39,8 ± 9,4 Monate. Der kombinierte primäre Endpunkt (3-Punkte MACE bestehend aus Myokardinfarkt, Hirnschlag und kardiovaskuläre Mortalität) trat bei 6,5% der Patienten in der Semaglutid-Gruppe im Vergleich zu 8,0% der Patienten in der Placebo-Gruppe auf (Hazard Ratio [HR] = 0,80; 95% CI, 0,72 bis 0,90; P < 0,001). Die Interventionsgruppe wies eine durchschnittliche Gewichtsreduktion von 8.5% gegenüber der Kontrollgruppe auf. Bemerkenswert ist der früh einsetzende Therapievorteil unter Semaglutid, lange bevor der maximale Gewichtsverlust erreicht wurde. Dies lässt Spekulationen offen, ob hier auch direkte gefässschützende Effekte von Semaglutid eine Rolle spielen. Der SELECT Trial hat die Adipositas als pharmakologisches Therapieziel in der kardiovaskulären Sekundärprävention zweifellos etabliert. Im Wissen um den Rebound-Effekt nach Absetzen von GLP-1 Agonisten muss man von einer dauerhaften Therapie ausgehen, um die Adipositas langfristig im Zaum zu halten. Das kann für die Betroffenen teuer werden, da die Therapiekosten für GLP1-Agonisten in der CH bei nicht Diabetikern in aller Regel nicht von den Krankenkassen übernommen werden.
Prof. Otmar Pfister
1. Look AHEAD Study Group, New Engl J Med 2013
2. Lincoff AM et al. New Engl J Med 2023
Rehabilitation der Ergometrie als Ischämietest?
Zum Nachweis oder Ausschluss einer obstruktiven koronaren Herzkrankheit ist die Ergometrie nicht perfekt. Ein Schwachpunkt der Ergometrie sind die falsch positiven Befunde, insbesondere bei Frauen. Eine englische Forschungsgruppe hat nun untersucht, ob diese falsch positiven Befunde wirklich falsch sind oder ob sie eine Ischämie aufgrund einer mikrovaskulären Krankheit anzeigen (1). 102 Patienten mit pektanginösen Beschwerden (65% Frauen, mittleres Alter 60 Jahre) mit erhaltener LV-Auswurffraktion ohne Koronarstenosen wurden invasiv mittels aufwändiger physiologischen Messungen abgeklärt bezüglich mikrovaskulärer Dysfunktion. Im Anschluss daran wurde eine Ergometrie durchgeführt.
32 Patienten entwickelten eine Ischämie im EKG (horizontale oder deszendierende ST-Senkung ≥1 mV). Bei 70 Patienten fanden sich keine Ischämiezeichen im Belastungs-EKG. Patienten mit Ischämiezeichen hatten vor dem Test häufiger typische Angina pectoris, verglichen mit den Patienten ohne Ischämie (91% vs. 73% P<0.05). Während der Belastung verspürten in beiden Gruppen gleich viele Patienten Angina pectoris. Bei den Patienten mit Ischämiezeichen im EKG war bei allen in der invasiven physiologischen Abklärung eine mikrovaskuläre Dysfunktion festgestellt worden, während dies nur bei 66% der Patientinnen ohne Ischämiezeichen im EKG der Fall war. Die Studie zeigt erstens, dass eine ST-Senkung bei Patienten ohne Koronarstenose in der Tat eine Ischämie anzeigt, nämlich eine Ischämie bedingt ist durch die mikrovaskuläre Dysfunktion und zweitens, dass das Auftreten von Angina in der Ergometrie nicht ein zuverlässiger Indikator für eine Ischämie ist. Zu beachten ist aber auch, dass eine mikrovaskuläre Dysfunktion bei normalem Belastungs-EKG nicht ausgeschlossen ist.
Prof. Franz Eberli
1. Sinha A et al. Rethinking false positive exercise electrocardiographicstress tests by assessing coronary microvascular function JACC 2024;83(2):291-299.
Aneurysma der Aorta ascendens: Wann operieren?
Bei sporadisch auftretenden Aneurysmen der Aorta ascendens empfehlen die Richtlinien eine operative Behandlung bei einer Grösse >5,5 cm und bei Vorliegen von bikuspiden Klappen, positiver Familienanamnese oder Bindegewebserkrankungen bei einer Grösse > 5 cm. Die Indikation für eine operative Behandlung besteht auch bei einem Grössenwachstum von 5 mm/Jahr. Die Daten für diese Empfehlungen sind nicht sehr robust und beruhen weitgehend auf der Datenbank für thorakale Aortenaneurysmen der Yale Universität.
Kürzlich hat dieselbe Forschungsgruppe die Resultate der 30-jährigen Beobachtung für den natürlichen Verlauf bei nicht-operierten Aneurysmen der Aorta ascendens veröffentlicht. Bei 964 Patienten wurde die Grössenzunahme des Aneurysmas, der Einfluss von Risikofaktoren und schliesslich die Ereignisrate über 7,9 Jahre (maximal 34 Jahre) untersucht. Bis zu einer Grösse von 3,5-4,9 cm waren die jährlichen Ereignisse gering (0,2-0,3%/Jahr). Ab einer Grösse von 5.0 cm stieg aber die Ereignisrate für eine Dissektion, Ruptur oder Tod steil an und betrug 1,4%/Jahr, bei einer Grösse von >5.5 cm schon 2.0%/Jahr und bei >6 cm gar 3,5%/Jahr. Bei einer Grösse des Aneurysmas von 4,5-4,9 cm kam es bei 2% der Patienten im Verlauf der 7,9 Jahre zu einer Dissektion, bei einer Grösse von 5,0-5,4 cm bei 11,3%! Die jährliche Grössenzunahme der Aneurysmen betrug im Mittel 1 mm mit einer Spannweite von 0,6 bis 1,8 mm. Risikofaktoren für eine Dissektion/Ruptur waren die Dimension des Aneurysmas und zunehmendes Alter. Klassische kardiovaskuläre Risikofaktoren hatten keinen Einfluss auf den Verlauf.
Die Autoren und das begleitende Editorial stellen gleich zwei Empfehlungen der Guidelines in Frage. Erstens scheint es sinnvoll, die Grenze für eine operative Sanierung der Aneurysmen der Aorta ascendens von 5,5 cm auf 5 cm zu senken. Zweitens tritt eine schnelle Grössenzunahme (>5 mm/Jahr) des Aneurysmas sehr selten auf und dieses Kriterium ist damit klinisch nicht hilfreich. Die neuen amerikanischen Guidelines empfehlen eine Evaluation zur operativen Sanierung bei Aneurysmen >5 cm, aber nur wenn ein tiefes Operationsrisiko besteht und das operative Team gute Resultate vorlegen kann. Die europäischen Guidelines werden zurzeit überarbeitet. Fast sicher wird die Interventionsschwelle von 5,5 cm verschoben oder zumindest differenziert diskutiert werden.
Prof. Franz Eberli
1. Erbel R et al., 2014 ESC Guidelines. Eur Heart J 2014;35:2873-2926
2. Isselbacher EM et al., 2022 ACC/AHA Guideline J Am Coll Cardiol 2022;80:e223-e393.
3. Wu J, et al. Fate of the unoperated ascending thoracic aortic aneurysm: three-decade experience form the Aortic Institute at Yale University. Eur Heart J 2023; 44:4579-4588
4. Hultgren R and Sakalihasan N. Do we need new Thresholds for surgical repair in patients with ascending thoracic aortic aneurysm disease? Eur Heat J 2023;44:4589-4591
Otmar.pfister@usb.ch
Stadtspital Zürich Triemli
Klinik für Kardiologie
Birmensdorferstrasse 497
8063 Zürich
franz.eberli@triemli.zuerich.ch
info@herz+gefäss
- Vol. 14
- Ausgabe 1
- Februar 2024