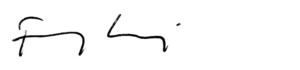- Der Mensch ist, was er isst.
Ganz in diesem Sinne strebt die Biopolitik der westlichen Regierungen an durch Vorschriften zur Nahrung und durch Erziehung der Bevölkerung die Volksgesundheit zu verbessern. Krankheiten wie Diabetes, Arteriosklerose, Krebserkrankungen sollen eingedämmt werden. Diesem Ziel kann nicht ernsthaft widersprochen werden. Aber es stellt sich die Frage, wie es am besten erreicht werden kann. Denn was ist «gesundes», was «besseres» Essen? Ist es einfach wenig Zucker, wenig Salz, wenig Fett, viel Gemüse? Das sind die Makronährstoffe. Was ist die richtige Menge an Mikronährstoffen (Vitamine, Spurenelemente, essentielle Aminosäuren)? Wie müssen wir neue Entwicklungen, wie genetisch veränderte Lebensmittel, Metabolomik, Proteomik, Nahrungszusätze, Ernährungsmedizin (culinary medicine), Erkenntnisse der Interaktion von Darmflora und Essen, für die gesunde Ernährung berücksichtigen? Ernährungsstudien sind schwierig durchzuführen und gute Evidenz ist eher spärlich. Studien wären aber wichtig, weil Empfehlungen basierend auf pathophysiologischen Überlegungen nicht genügen. So haben wir früher, überzeugt von ihrem Nutzen, die Diabetes Diät beim Diabetes und die cholesterinarme Diät bei der Hypercholesterinämie verordnet. Beide Massnahmen hatten wenig Effekt und sind inzwischen verschwunden. Nichtsdestotrotz entstand nun eine Bewegung «Food-is-Medicine». Soll dieses Konzept Erfolg haben, dann muss noch viel Wissen erarbeitet werden. Denn Nahrung ist kein Medikament. Beim Medikament wird die exakte Dosis eines Wirkstoffs eingenommen. Bei der Nahrung ist nicht nur der «Wirkstoff» nicht dosierbar, sondern die Zubereitung und Einnahme ist abhängig von den Vorlieben, Gewohnheiten, kulturellen Bräuchen und von religiösen und sozialen Regeln und Geboten. Eine erste grosse Studie, die das Konzept «Food-is-Medicine» prüfte ist denn auch kläglich gescheitert (1). In der Studie wurden Patienten mit Diabetes Typ II während sechs Monaten mit ausgewählten Nahrungsmitteln versorgt und von Ernährungsberatern eng betreut. Verglichen mit der Kontrollgruppe hat die aufwändige Intervention nicht nur den Diabetes nicht verbessert, sondern das Körpergewicht der behandelten Patienten nahm zu statt ab. Ein Defizit an zuverlässigem Wissen bei den Ernährungsexperten wurde offensichtlich. Das New England Journal of Medicine will unser Wissen bezüglich der Effekte von Diätinterventionen stärken, oder besser unser Unwissen senken, und vermehrt Arbeiten zu diesem Thema veröffentlichen (2). Die Herausgeber weisen darauf hin, dass für eine korrekte Ernährung viele Aspekte berücksichtigt werden müssen. Zum einen ändern die Bedürfnisse im Laufe des Lebens. Die optimale Ernährung für Kinder, Schwangere und betagte Menschen unterscheidet sich substantiell. Zudem verlangen eine Vielzahl von Krankheiten, wie Polymorbidität, Lebensmittelunverträglichkeiten, entzündliche Darmerkrankungen, Betreuung nach bariatrischer Operation eine spezielle Ernährung. Im Lichte dieser offensichtlichen Komplexität scheint der gegenwärtige Ansatz einer vom Staat vorgeschriebenen Anpassung der Nahrungszusammensetzung (z. B. eidgenössische Salzinitiative) nicht sinnvoll. Bei fehlender guter Evidenz der Auswirkung auf die gesamte Bevölkerung kann damit mehr Schaden als Nutzen entstehen.
Zum Schluss sei noch einmal an die Feuerbach’sche Sinnlichkeit als Wesensmerkmal des Menschen erinnert. Ein feines Essen ist wohltuend für die seelische und körperliche Gesundheit. Massvoller Genuss ist sinnvoll und nicht verboten.
Prof. Dr. med. Franz Eberli
1. JAMA Intern Med. 2024;184(2):154-163.
2. New Engl J Med 2024;390(14):1324-25
Stadtspital Zürich Triemli
Klinik für Kardiologie
Birmensdorferstrasse 497
8063 Zürich
franz.eberli@triemli.zuerich.ch