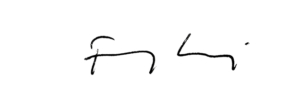- Neue Verfahren in der interventionellen Kardiologie: Gibt es einen Mehrwert?
CTO manifestieren sich klinisch meist als stabile Angina pectoris. Der Mehrwert der perkutanen Revaskularisation (PCI) von CTO wurde anfänglich wegen der relativ hohen Komplikationsrate und der hohen Restenoserate in Frage gestellt. Neuerdings ist um die Revaskularisation der chronischen koronaren Herzkrankheit im allgemeinen eine Diskussion entstanden. Bei Vergleich einer initial medikamentösen vs. einer initial invasiven Strategie ergab sich im Verlauf von 2-3 Jahren zwar eine bessere Symptombefreiung, aber kein prognostischer Mehrwert durch die Revaskularisation. Wahrscheinlich aufgrund der gegenwärtigen Kontroverse sind die Autoren bei der Beschreibung der Indikationsstellung für eine PCI bei CTO eher defensiv. Diese vorsichtige Haltung ist lobenswert, da der Nutzen einer PCI deren Risiken weit übersteigen muss. Der Mehrwert der CTO PCI muss aber auch im Rahmen der Alternativen gewertet werden. Die Bypassoperation ist mit noch höheren Komplikationsraten behaftet als die PCI. Die Einlage eines Koronarsinusreducers, welcher durch eine Umverteilung des myokardialen Blutflusses die Ischämie vermindert, geht ebenfalls einher mit Risiken und hat zu oft einen geringen Effekt auf die Symptome. Es bleibt die medikamentöse Therapie, welche leider in vielen Fällen keine Symptomfreiheit bringt. Die erwähnten Vergleichsstudien untersuchten die prognostischen, harten Endpunkte Tod, Myokardinfarkt und Notwendigkeit für eine Revaskularisation, dh. die so genannten clinical outcome measures (CROM). Der fehlende prognostische Unterschied ist für die Patient*innen oft nicht relevant. Sie erhoffen sich von der Intervention Symptomfreiheit und eine verbesserte Lebensqualität. In allen Vergleichsstudien hat dies die PCI besser erreicht als die medikamentöse Therapie. Diese patient reported outcome measures (PROM) (=Symptomfreiheit) und patient reported experience measures (PREM) (= Lebensqualität) sind ebenso wichtig in der Beurteilung des Mehrwertes einer Behandlung. Aus dem Gesagten geht aber auch hervor, dass bei Beschwerdefreiheit des Patienten eine CTO PCI einen beschränkten Mehrwert aufweist.
Der Mehrwert der PCI von CTOs ist noch weiter zu sehen. Erstens ging mit der Erarbeitung der Technik ein enormer Wissenszuwachs bezüglich der Physiologie der Kollateralen einher. Zweitens sind im Laufe der Zeit immer bessere Drähte, Mikrokatheter und Ballonkatheter entwickelt worden, die inzwischen breit eingesetzt werden. Weiter mussten für die PCI neue Interventionstechniken gefunden werden, welche nun bei schwierigen PCI allgemein angewendet werden. Beides hat die PCI insgesamt erfolgreicher und sicherer gemacht.
Der Mehrwert des Vorhofohrverschlusses liegt auf der Hand. Er ermöglicht den Patient*innen mit Vorhofflimmern, welche eine Kontraindikation für eine OAK haben, einen Schutz vor thromboembolischen Komplikationen. Auch Patient*innen mit einer fehlenden oder schlechten Compliance für eine OAK profitieren von einem Vorhofohrverschluss. Hinweise auf das Ausmass der Problematik gaben die Vergleichsstudien NOAC vs. Vitamin-K abhängige OAK. In allen Studien stoppten in der Nachbeobachtungsphase jedes Jahr 7-9% die OAK. In der Rocket AF hatten nach 2 Jahren 23,9% das Rivaroxaban und 22,4% die OAK gestoppt! Der Vorhofohrverschluss wirkt unabhängig von der Compliance des Patienten lebenslang.
Warum ist die Skepsis dem Mehrwert des Vorhofohrverschlusses gegenüber trotzdem gross? Der perkutane Vorhofohrverschluss ist eine aufwändige Intervention, welche mit einer relativ hohen Rate auch schwerwiegender Komplikationen einhergeht. Das Interventionsrisiko wird auch in erfahrenen Händen nie null sein. Deshalb wird immer ein Abwägen zwischen dem initialen Interventionsrisiko und der Verminderung des Langzeitrisikos nötig sein. Die gegenwärtig laufenden Vergleichsstudien NOAC vs. Vorhofohrverschluss werden nicht nur Auskunft geben über die Gleichwertigkeit der beiden Behandlungen, sondern auch das gegenwärtige Risiko des Vorhofohrverschlusses dem Nutzen im Langzeitverlauf gegenüberstellen. Diese genauere Kenntnis der Langzeitrisiken wird es ermöglichen, die Indikation für den Vorhofohrverschluss bei verschiedenen Zuständen besser gegen den Nutzen abzuwägen.
Der Prävention von thrombo-embolischen Ereignissen bei Vorliegen eines hohen Blutungsrisikos sind Grenzen gesetzt. Die Erarbeitung von neuen Techniken, z.B. den Vorhofohrverschluss, um diese Grenzen zu sprengen, bringt per se einen nicht zu unterschätzenden Mehrwert.
Prof. Dr. med. Franz Eberli
Stadtspital Zürich Triemli
Klinik für Kardiologie
Birmensdorferstrasse 497
8063 Zürich
franz.eberli@triemli.zuerich.ch