- Patientenforum Onkologie und Hämatologie: Konzept der gemeinsamen Entscheidungsfindung

Dr. Ellen Heitlinger, CEO von healthbook, begrüsste die zahlreichen Interessierten, die am Samstagmorgen nach Bern gekommen waren, um sich über ein Konzept zu informieren, das mittlerweile in allen medizinischen Disziplinen Einzug gehalten hat. «Passend zum Weltkrebstag am 4. Februar und im Vorfeld des Darmkrebsmonats März wollen wir den Blick auf die gemeinsame Entscheidungsfindung schärfen», so die Organisatorin des Forums. Dieses verfolge einen ganzheitlichen Ansatz. Nicht nur onkologische, sondern auch chronische Erkrankungen sollen beleuchtet werden, bei denen die gemeinsame Entscheidungsfindung eine ebenso zentrale Rolle spielt. Patientinnen und Patienten setzen in der Regel andere Prioritäten als Ärztinnen und Ärzte, so ist die Verträglichkeit oft wichtiger als die Wirksamkeit einer Therapie. Patientinnen und Patienten sollten daher aktiv in Entscheidungen über die Behandlung ihrer Krankheit einbezogen werden.
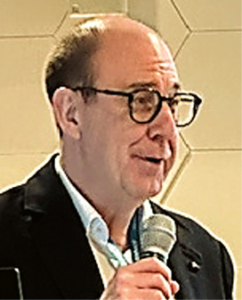
Prof. von Moos erinnerte zunächst mit der folgenden Illustration an die Zitate von Snoopy über das Leben und das Glück, «In den letzten Jahren haben wir viel in Bezug auf Multidisziplinarität und Interprofessionalität für den Patienten getan, aber wir hinken noch etwas hinterher, dies gemeinsam mit dem Patienten anzugehen. Im heutigen Patientenforum werden wir verschiedenste Aspekte dieses wichtigen Themas angehen» so der Referent.
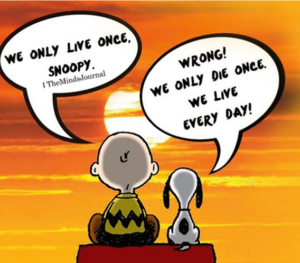
Angehörige der Gesundheitsberufe müssen anerkennen, dass ihre Patienten oft mehr über einen bestimmten Aspekt ihrer Behandlungssituation wissen als sie selbst. Sie sind somit auch «Spezialisten», deren Wissen, Meinung und Entscheidungskompetenz respektiert werden muss. Auf dieses «Empowerment» zielt das Konzept der gemeinsamen Entscheidungsfindung ab.
SESSION 1:
Das Konzept verstehen: Shared Decision Making in Onkologie und Hämatologie
Grundlagen und Prinzipien der gemeinsamen Entscheidungsfindung
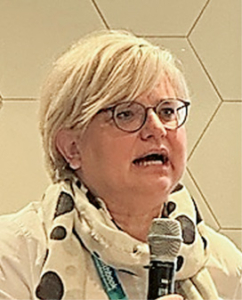
«Eine effektive Versorgung in der Onkologie/Hämatologie setzt sich zusammen aus der Wahl der medizinischen Behandlung, der Evidenz der Nachteile und Vorteile, den Bedürfnissen, Werten und Präferenzen des Patienten und einer «präferenzsensiblen» Entscheidung», so PD Dr. med. Martina Kleber, Chefärztin Institut für Allgemeine Innere Medizin, Hirslanden Klinik, Zürich.
Die Phasen des Shared Decision Making sind
Schritt 1: Suche nach der Teilnahme des Patienten
Schritt 2: Helfen Sie Ihrem Patienten, Behandlungsoptionen zu erkunden und zu vergleichen
Schritt 3: die Werte und Vorlieben Ihres Patienten einschätzen
Schritt 4: Treffen Sie eine Entscheidung mit Ihrem Patienten
Schritt 5: Bewerten Sie die Entscheidung des Patienten
Konzepte der gemeinsamen Entscheidungsfindung: informierte Entscheidung, wertebasierte Entscheidung, patientenzentrierte Versorgung, Zusammenarbeit, kontinuierlicher, partnerschaftlicher Dialog.
Grundsätze der gemeinsamen Entscheidungsfindung
Evidenzbasierte Information, Deliberation und Abwägung, Einbeziehung des Patienten, Autonomie des Patienten, unterstützendes Umfeld – erleichterter Dialog.
Vorteile von Shared Decision Making: Verbesserte Kommunikation, Patientenzufriedenheit, Therapietreue / Compliance, Positive Auswirkungen auf die Gesundheit des Patienten.
Digitale Entscheidungshilfen
Unterstützung im Vorfeld zur Vorbereitung auf Shared Decision Making. Bereitstellung von standardisierten, meist evidenzbasierten Informationen über Krankheiten, mögliche medizinische Massnahmen und damit verbundene Vor- und Nachteile sowie Risiken. Elektronische bzw. webbasierte Entscheidungshilfen können helfen, Lücken in der Vorbereitung der Patienten zu schliessen und sie so im Prozess des SDM zu unterstützen.
Chatbot als effiziente Hilfe
Textbasierte Dialogsysteme, Chat per Texteingabe oder Sprache mit einem automatisierten System, text- oder sprachbasierter Dialog mit dem Nutzer über eine interaktive Schnittstelle. Dies spart Zeit und bereitet das Gespräch mit dem Arzt vor.
Schlussfolgerungen
– Therapieentscheidungen in der Onkologie/Hämatologie sind komplex
– Gemeinsame Entscheidungsfindung ist ein kontinuierlicher Prozess
– Häufig im Kontext von Breaking Bad News
– Unterstützende Umgebung – erleichterter Dialog
– Unterstützung durch digitale Werkzeuge.
Patientenzentrierte Versorgung durch Shared Decision Making stärken
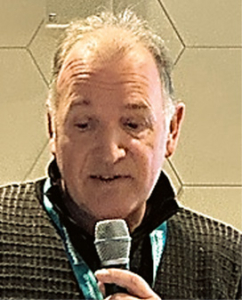
Erik Aerts, Abteilungsleiter Pflege am USZ betonte die zentrale Rolle der Kommunikation in der gemeinsamen Entscheidungsfindung. Besprechung von Behandlungspräferenzen und -prioritäten zum Verständnis dessen, was Patienten brauchen, um fundierte Entscheidungen zu treffen, sind essenziell. Es sollte effektiv kommuniziert werden, zurück zu den 5 As (Ask, Assess, Advice, Assisst, Arrange), so der Referent.
Aus Sicht der Pflege zeigte Erik Aerts auf, wie sehr klar und respektvoll vermittelte Informationen über Behandlungsoptionen, Risiken und Vorteile einer Krebsbehandlung den Patienten helfen können, fundierte Entscheidungen zu treffen und eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Fachpersonen und Patienten zu schaffen. Er warnte vor unrealistischen Erwartungen und vor den Gefahren von Fehlinformationen aus den Medien oder dem Internet.
Was fehlt oft?
Die Diskussionen über Behandlungen konzentrieren sich oft auf SOM aber Patienten mit hämatologischen Erkrankungen brauchen mehr. Dazu gehören auch Diskussionen über die Planung des Lebensendes, die realistische Prognosen erfordert.
SESSION 2:
Gemeinsame Entscheidungsfindung und die Rolle eines multidisziplinären Tumorboards
Berührungspunkte zwischen gemeinsamer Entscheidungsfindung und einem multidisziplinären Tumorboard

Zu den Beziehungen und Problemen zwischen gemeinsamer Entscheidungsfindung und den Entscheidungen des Tumorboards referierte Dr. Michael Montemurro, Clinique Genolier Genf.
Teamarbeit findet in der Krebsmedizin bereits innerhalb der Ärzteschaft statt. Die behandelnden Onkologen, Pathologen, Radiologen sowie organspezialisierte Fachärzte treffen sich in multidisziplinären Tumorboards und beleuchten und bewerten Diagnosen, Therapieentscheidungen und Therapieverläufe aus unterschiedlichen Perspektiven. Im anschliessenden Gespräch mit dem Patienten kann sich der Weg der gemeinsamen Entscheidungsfindung ebenso komplex gestalten wie die Therapieauswahl selbst. Denn die Patientenpräferenzen können sich unter anderem auf die Wahl der Therapieziele (z.B. Heilung oder Verbesserung der Lebensqualität), die Art der Therapie (Chemotherapie oder Immuntherapie) sowie die jeweiligen Risiken und Nebenwirkungen beziehen. Abschliessend verwies der Referent auf die Ergebnisse einer Umfrage zu wahrgenommenen Hindernissen und benötigten Ressourcen:
– Der Patient ist mit der Entscheidung überfordert (53%),
– Der Patient möchte, dass sein Arzt die Entscheidung trifft (46%)
– Der Patient hat eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz (46%)
– Ich wurde nicht ausreichend geschult, um an der gemeinsamen Entscheidungsfindung teilzunehmen (13%).
SESSION 3:
Fähigkeiten für bessere gemeinsame Entscheidungen stärken: Übungen, die helfen
Welche Kompetenzen müssen verbessert werden und wie?
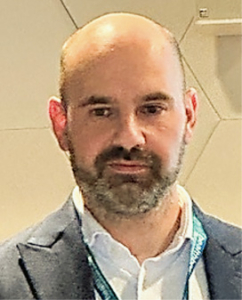
Der Onkologe Dr. Alexander Meisel (Glarus) betonte die grosse Bedeutung des kontinuierlichen Dialogs mit den Patienten. Ausreichend Zeit, klare Kommunikation, gute Vorbereitung sowie der Einsatz von verständlichen Materialien und Bildern seien dabei entscheidend. Wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Shared Decision Making seien zudem verlässliche Diagnosedaten, zeitnahe Laborergebnisse und leicht zugängliches Informationsmaterial.
Der Referent betonte, dass Ärzte und Patienten zu jedem Zeitpunkt der Behandlung ein Behandlungsteam bilden und vor allem immer auf dem neuesten Stand der Behandlung sein sollten. Wenn Disease Management keine Worthülse bleiben solle, müsse es zeigen, dass es mehr als ein theoretisches Konzept sei. Deshalb müssten sich alle an der Behandlung und Betreuung Beteiligten täglich für eine vertrauensvolle, partnerschaftliche und transparente Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten einsetzen, so der Referent. Ziele einer partizipativen Behandlungsentscheidung sollten sein, so Dr. Meisel:
– Die Präferenzen des Patienten genau kennen
– Patienten bestmöglich und verständlich informieren
– Trotz der Präferenzen des Patienten die bestmögliche Behandlungsentscheidung treffen, insbesondere wenn mehrere Optionen zur Verfügung stehen
– Gesamtüberleben
– Tumorkontrolle
– Nebenwirkungen
der Wahrheit so nahe wie möglich kommen.
Partizipative Behandlungsentscheidung SDM – Was bevorzugen die Patienten?
Eine Untersuchung an 1081 Patienten (48.6% weiblich) ergab die folgenden Resultate
– 402 Patienten (37.2%) bevorzugen die Kontrolle über ihre Behandlung zu behalten
– 400 Patienten (37.0%) bevorzugen die Kontrolle mit ihrem Arzt zu teilen
– 279 Patienten (25.5%) bevorzugen die Kontrolle dem behandelnden Arzt zu überlassen.
– Bei Patienten zwischen 18 und 40 Jahren war die Wahrscheinlichkeit höher, die Kontrolle über die Behandlung selbst behalten zu wollen. Ein gleicher Trend war bei höherer Bildung und höherem Einkommen zu beobachten.
– Patienten mit metastasierter Erkrankung wollten häufiger eine gemeinsame Entscheidungsfindung.
Partizipative Entscheidung/SDM: Auswirkungen auf den Praxisalltag und Patienten
Es wurde festgestellt (Abukmail E et al. Pat Educ Count 2024 Dec; 129:1o8408), dass die Umsetzung von SDM in der Regel weder Kosten noch die Konsultationszeit erhöht, während es für bestimmte Bevölkerungsgruppen neutrale bis positive Auswirkungen auf die Ergebnisse und die Qualität hat. Es bestehen weiterhin Wissenslücken, einschliesslich einer besseren Erforschung des Klimas, in dem SDM am effektivsten ist.
Wichtige Voraussetzungen für eine partizipative Behandlungsentscheidung: die persönliche Meinung des Referenten
– Patient und behandelnder Arzt sollten immer ein Behandlungsteam sein
– Wir sind Berater – keine Patriarchen
– Alle Hindernisse sollten uns nicht davon abhalten, eine bestmögliche, patientenorientierte Behandlung zu bieten
– SDM spart am Ende Zeit und Energie
SESSION 4:
Patientenforum Perspektiven von Patientinnen und Patienten erforschen
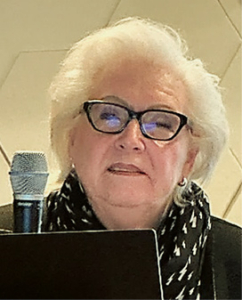
Rosmarie Pfau aus Aesch, Gründerin und Präsidentin des Patientennetzes Lymphome Schweiz (lymphome.ch), war selbst Lymphom-Patientin. Sie berichtete von den Erfahrungen von Patienten mit dem Thema gemeinsame Entscheidungsfindung im Alltag. Dabei stützte sie sich insbesondere auf Daten einer Umfrage des Lymphom-Patientennetzes.
Die Befragung ergab, dass etwa 30% der Patienten stärker in den Entscheidungsprozess einbezogen werden könnten, was die Behandlungserfahrung verbessern und eine stärkere Patientenorientierung ermöglichen würde. 40% der Patienten würden Therapieentscheidungen lieber gemeinsam mit dem behandelnden Arzt treffen. Rosmarie Pfau betonte, wie wichtig eine auf den Patienten und seine persönlichen Lebensumstände zugeschnittene Unterstützung, anschauliches Informationsmaterial und die individuelle Begleitung durch Patientenorganisationen seien.
Gemeinsame Entscheidungsfindung ist sinnvoll, so die Referentin
– bei chronischen und akuten Erkrankungen
– bei Behandlungen mit mehreren gleichwertigen Alternativen
– bei Behandlungen mit grossen Risiken oder Nebenwirkungen
Beteiligung an der Entscheidungsfindung laut Lymphoma Coalition Global Patient Survey 2024/Schweiz: 64% der Patienten wurden in dem Masse in Entscheidungen über ihre Versorgung und Behandlung einbezogen, wie sie es wünschten. 29% fühlten sich bis zu einem gewissen Grad so einbezogen, wie sie es wünschten 4% wünschten sich eine stärkere Einbeziehung 1% wünschten sich keine Einbeziehung.
Als besonders wichtig erachtet die Referentin die Information und Erklärung der empfohlenen Therapieoptionen, die Information über mögliche Nebenwirkungen, die Berücksichtigung ihrer beruflichen Situation, d.h. eine Therapie, bei der sie weiterarbeiten kann, die Entscheidung gemeinsam mit dem Arzt zu treffen.
Gemeinsame Entscheidungsfindung aus Sicht der Patientenbetreuung
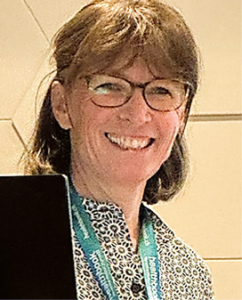
Darüber, wie sich die Umsetzung des Konzepts der gemeinsamen Entscheidungsfindung im Alltag aus der Perspektive der Patientenbetreuung und Pflege gestaltet, sprach die diplomierte Pflegefachfrau Onkologie, Rita Deininger, vom Tumor und BrustZentrum,St. Gallen.
Sie verglich den Prozess mit einer Bergtour, bei der ein guter Führer dank vorausschauender Planung auch auf schwierige Wetterbedingungen vorbereitet ist. Zusammen mit einer Haltung im Sinne «Hope for the best, be prepared for the worst» würden Weitsicht, Vertrauen und enge Zusammenarbeit zwischen Patienten, Angehörigen und medizinischen Fachpersonen Patienten gerade in schwierigen Situationen unterstützen. Zum Beispiel bei der Frage, wie es weitergeht, wenn eine Palliativpflege im Raum steht.
Hinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personen und Berufsbezeichnungen, die in diesem Text im männlichen Geschlecht aufgeführt sind, gelten daher selbstverständlich gleichermassen für alle Geschlechter.
riesen@medinfo-verlag.ch






