- Weiterentwicklung von zellulären Immuntherapien
Am 23.10. wurden in Zürich die diesjährigen Preisträger des SWISS BRIDGE AWARD gekürt. Den Preis im Wert von 500 000 Franken durften sich ein Forschungsteam aus Genf und eines aus Heidelberg teilen. Beide Gruppen beschäftigen sich mit der Weiterentwicklung von zellulären Immuntherapien, die eine Verringerung der Nebenwirkungen und eine Ausweitung der Anwendung von zellulären Immuntherapien zum Ziel haben. Die Laudatio hielt Prof. Gordon McVie, Präsident der wissenschaftlichen Jury, nach einer Einführung durch den Präsidenten des Stiftungsrates, Prof. Jakob Passweg, Basel.
Insgesamt 52 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich um den Swiss Bridge Award 2019 beworben. Die aus international renommierten Expertinnen und Experten zusammengesetzte Jury wählte in einem zweistufigen Verfahren zwei Projekte aus. Die Projektleiter Dr. med. Denis Migliorini, Genf und Dr. med. Lukas Bunse, Heidelberg, erhielten die Preise zur Realisierung ihrer Forschungsvorhaben. Der diesjährige Preis der privaten Stiftung Swiss Bridge ging an Projekte zur zellulären Immuntherapie. Bei dieser neuen Therapieform werden körpereigene Abwehrzellen von Tumorpatientinnen und -patienten ex vivo gentechnisch verändert und vervielfacht dem Körper zurücktransfundiert, wo sie dank der genetischen Aufrüstung verstärkt gegen die Tumorzellen vorgehen können. Diese neue Anwendung der zellulären Immuntherapie hat bei einigen Patienten zu spektakulären Erfolgen geführt. Diese Therapien können aber mit schwerwiegenden Nebenwirkungen einhergehen und sie haben sich bislang vor allem bei verschiedenen Arten von Blutkrebs als erfolgreich erwiesen. Der Preis ging deshalb an eine Forschungsgruppe, die sich vorwiegend mit den Nebenwirkungen befasst und eine, die eine Ausweitung der Therapie auf Hirntumore untersucht.
Neurotoxische Nebenwirkungen verringern

Die Forschungsgruppe um Dr. med. Denis Migliorini am Laboratory of Tumor Immunology and Department of Oncology, am Universitätsspital Genf arbeitet daran, die beträchtlichen neurotoxischen Nebenwirkungen, die mit den aktuell zugelassenen zellulären Immuntherapien einhergehen, zu verringern. Bei bis zu 30 bis 50 Prozent der behandelten Patientinnen und Patienten treten neurotoxische Nebenwirkungen auf. Diese reichen von vorübergehenden neurologischen Ausfällen, wie Beschwerden beim Gehen oder Sprechen, bis zu schweren Anfällen mit komatösen Zuständen, die in einigen wenigen Fällen sogar tödlich enden können.
Dr. Migliorini und sein Team haben herausgefunden, dass das Zielmolekül der genetisch veränderten Abwehrzellen nicht nur auf der Oberfläche von Krebszellen vorhanden ist, sondern auch auf der Oberfläche der Perizyten. Diese sind zusammen mit den Endothelzellen und den Astrozyten für Funktion sowie Aufbau und Entwicklung der Blut-Hirn-Schranke von grosser Bedeutung. Die Gruppe um Dr. Migliorini hat in ihrem Forschungsprojekt das Ziel, die Abwehrzellen mit einem zusätzlichen Gen auszurüsten, welches den gentechnisch veränderten Zellen erlaubt, zwischen den Krebszellen und den Perizyten zu unterscheiden. Dadurch würden nur noch die Krebszellen abgetötet.
Immuntherapien für Hirntumoren
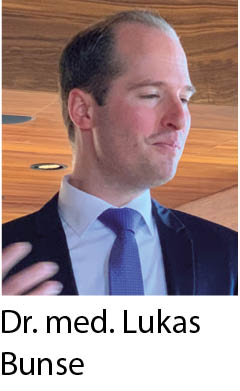
Zelluläre Immuntherapien haben bisher vor allem bei der Bekämpfung verschiedener Arten von Blutkrebs Erfolge gezeitigt. Dr. med. Lukas Bunse und sein Team sind nun daran, die Behandlungsmethode auf Gliome auszuweiten. Das sind Hirntumoren, die umgebendes Gewebe infiltrieren und aufgrund ihres invasiven Wachstums mit einer operativen Entfernung derzeit nicht zu heilen sind. Die Forscher um
Dr. Bunse haben in bisherigen Studien vielversprechende Zielmoleküle in den Gliomzellen ausfindig gemacht und beabsichtigen, im geplanten Forschungsprojekt neue genetisch veränderte Abwehrzellen herzustellen, die sich gezielt gegen diese Strukturen der Hirntumorzellen richten. Anschliessend planen die Wissenschaftler – zunächst an Mäusen und anschliessend bei Patienten – zu überprüfen, ob diese Abwehrzellen in der Lage sind, die Ausbreitung der Gliome zu verhindern.
Dr. Lukas Bunse leitet die Gruppe Translationale Vakzinentwicklung und zelluläre Therapien in den neuroimmunologischen Laboratorien von Prof. Dr. Michael Platten, dem Direktor der Neurologischen Klinik der UMM und der Klinischen Kooperationseinheit «Neuroimmunologie und Hirntumorimmunologie» am DKFZ.
riesen@medinfo-verlag.ch
droux@medinfo-verlag.ch
info@onco-suisse
- Vol. 9
- Ausgabe 6
- Dezember 2019








